
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Spastische Lähmung
Facharzt des Artikels
Zuletzt überprüft: 04.07.2025
Lähmungen werden in zwei große Gruppen unterteilt: spastische und schlaffe Lähmungen. Spastik entsteht durch eine Schädigung des Rückenmarks im Hals- oder Brustbereich und ist auch charakteristisch für die meisten Fälle von Zerebralparese. Lähmungen werden auch nach dem Grad der Schädigung klassifiziert. Man unterscheidet zwischen partieller Lähmung, Parese genannt, und vollständiger Lähmung, Plegie genannt.
Epidemiologie
Ursachen spastische Lähmung
Dies ist eine Folge der Motoneuron-Pathologie. Da die Pyramidenbündel recht eng beieinander liegen, betrifft die Lähmung oft die gesamte Extremität oder die gesamte linke oder rechte Körperseite. Periphere Lähmungen betreffen meist bestimmte Muskeln oder Muskelgruppen. Doch diese Regeln haben Ausnahmen. So kann beispielsweise eine winzige Läsion in der Großhirnrinde eine Lähmung der Handfläche, der Gesichtsmuskulatur etc. verursachen; umgekehrt kann eine erhebliche Schädigung der Nervenfasern eine ausgedehnte periphere Lähmung verursachen.
Darüber hinaus sind Hirnverletzungen und Multiple Sklerose häufige Ursachen für Lähmungen. Die Hauptursache für spastische Lähmungen ist eine Störung der Nervensignalübertragung, die zu Muskelhypertonus führt.
Spastik kann auch eine Folge anderer Störungen und Krankheiten sein:
- Hirnfunktionsstörung aufgrund von Hypoxie;
- Infektionskrankheiten des Gehirns (Enzephalitis, Meningitis);
- Amyotrophe Lateralsklerose;
- Erblicher Faktor. Gemeint ist die familiäre spastische Strumpell-Lähmung, eine schleichende Erkrankung, die vererbt wird und mit der Zeit fortschreitet. Das Nervensystem baut sich allmählich ab, da die Pyramidenbahnen in den Rückenmarkssträngen betroffen sind. Diese Lähmungsform erhielt ihren Namen von A. Strumpell, der den familiären Charakter der Erkrankung erkannte. In der medizinischen Literatur wird sie auch als „familiäre spastische Paraplegie Erb-Charcot-Strumpell“ bezeichnet.
Risikofaktoren
Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer Lähmung im Mutterleib oder während der Geburt erhöhen, werden gesondert identifiziert:
- Niedriges Geburtsgewicht und Frühgeburt;
- Mehrlingsschwangerschaft;
- Infektionen während der Schwangerschaft;
- Rhesus-Unverträglichkeit der Blutgruppen;
- Intoxikation (z. B. Exposition gegenüber Methylquecksilber);
- Schilddrüsenfunktionsstörung der Mutter;
- Komplikationen während der Geburt;
- Niedrige Apgar-Werte;
- Gelbsucht;
- Krämpfe.
Symptome spastische Lähmung
Neben motorischen Funktionsstörungen gehen mit spastischen Lähmungen in fast allen Fällen weitere Störungen einher, darunter Bewusstseins-, Seh-, Hör-, Sprach-, Aufmerksamkeits- und Verhaltensstörungen.
Das erste Anzeichen einer Lähmung und der Hauptfaktor, der die Wiederherstellung motorischer Funktionen verhindert, ist Spastik. Spastik äußert sich in Hypertonie und unwillkürlichen Kontraktionen der betroffenen Muskeln. Kontraktionen treten in den Muskeln auf, die zuvor bewusst gesteuert werden konnten. In der ersten Phase nach einer Verletzung oder Erkrankung befindet sich das Rückenmark in einem Schockzustand, und Signale vom Gehirn werden nicht durch diesen Bereich übertragen. Reflexe in den Sehnen werden nicht erkannt. Nach Abklingen der Schockreaktion setzen sie wieder ein, die Funktion ist jedoch oft beeinträchtigt.
Die Muskeln sind angespannt und dicht, bei passiven Bewegungen ist ein Widerstand spürbar, der manchmal nur mit Anstrengung überwunden werden kann. Eine solche Spastik entsteht durch einen hohen Reflextonus und ihre ungleichmäßige Verteilung, wodurch typische Kontrakturen auftreten. Eine solche Lähmung ist leicht zu erkennen. Normalerweise wird ein Arm an den Körper gedrückt und am Ellbogen gebeugt, Hand und Finger sind ebenfalls gebeugt. Das Bein ist gestreckt, nur der Fuß ist gebeugt und die Zehe zeigt nach innen.
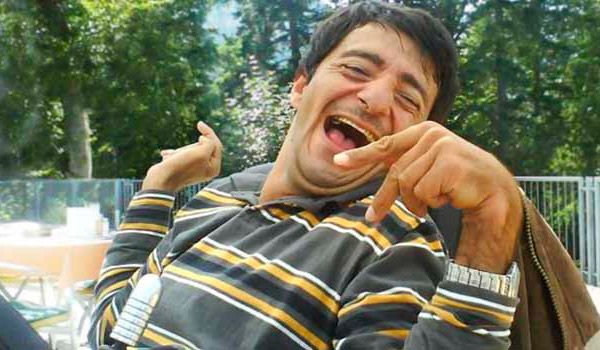
Hyperreflexie ist ein weiteres Anzeichen für eine Hyperaktivität des Rückenmarks. Die Reflexfunktion der Sehnen ist deutlich verstärkt, was sich bereits bei der geringsten Reizung bemerkbar macht: Der Reflexbereich wird größer: Der Reflex wird sowohl von der üblichen Zone als auch von angrenzenden Zonen ausgelöst. Sehnen- und Hautreflexe hingegen schwächen sich ab oder verschwinden ganz.
Assoziierte Bewegungen (auch Synkinese genannt) können unwillkürlich in den betroffenen Armen und Beinen auftreten, beispielsweise wenn sich gesunde Muskeln zusammenziehen. Dieses Phänomen erklärt sich durch die Tendenz von Impulsen im Rückenmark, sich auf benachbarte Segmente auszubreiten, die normalerweise durch die Arbeit der Großhirnrinde eingeschränkt sind. Bei spastischer Lähmung breiten sich Impulse mit größerer Kraft aus, was zu „zusätzlichen“, unwillkürlichen Kontraktionen der betroffenen Muskeln führt.
Pathologische Reflexe sind die wichtigsten und dauerhaften Symptome der spastischen Zerebralparese. Besonders hervorzuheben sind die Fußreflexe bei spastischer Beinlähmung: Babinski-, Rossolimo- und Bechterew-Symptome treten häufig auf. Andere pathologische Fußreflexe sind seltener. Solche Phänomene sind an gelähmten Armen nicht so ausgeprägt, daher liegen keine Daten dazu vor. Pathologische Reflexe der Gesichtsmuskulatur deuten auf eine beidseitige Läsion im Kortex, im Hirnstamm oder in der subkortikalen Region hin.
Diagnose spastische Lähmung
Bei der Differentialdiagnose einer spastischen Lähmung werden Symptome sowie Ergebnisse von Tests und Untersuchungen berücksichtigt.
Während der Konsultation untersucht der Neurologe den Patienten: Er achtet auf die Körperhaltung, die Motorik, die Muskelspannung und überprüft die Reflexe.
Um andere Erkrankungen mit den gleichen Symptomen auszuschließen – einen Hirntumor oder eine Muskeldystrophie – werden Untersuchungen mittels instrumenteller und Labordiagnostik durchgeführt:
- Bluttests;
- Röntgenaufnahme des Schädels;
- Computertomographie des Kopfes und der Wirbelsäule;
- Magnetresonanztomographie des Gehirns und der Wirbelsäule;
- Neurosonographie.
Behandlung spastische Lähmung
Muskelrelaxantien beseitigen Muskelhypertonie. Je nach Wirkmechanismus werden Relaxantien mit zentraler und peripherer Wirkung unterschieden. Die Praxis zeigt, dass die Anwendung von Muskelrelaxantien häufig zu unerwünschten Folgen und Komplikationen führt. Zu den Muskelrelaxantien, die das zentrale Nervensystem beeinflussen und häufig zur Linderung der Symptome spastischer Lähmungen eingesetzt werden, gehören Baclofen, Sirdalud und Diazepam.
Baclofen ähnelt Gamma-Aminobuttersäure, die an der präsynaptischen Signalhemmung beteiligt ist. Das Medikament unterdrückt synaptische Reflexe und die Funktion von Gamma-Efferenzen. Es überwindet problemlos die Blut-Hirn-Schranke. Es zeigt die beste Wirkung bei spinalen Formen der Spastik: Es beseitigt nicht nur Hypertonie und Krämpfe der motorischen Muskulatur, sondern wirkt sich auch positiv auf die Funktion der Beckenorgane aus. Bei Patienten mit einer Hirnerkrankung kann Baclofen die Konzentrations- und Erinnerungsfähigkeit beeinträchtigen. Erwachsenen werden 10–15 mg des Medikaments pro Tag verschrieben, die Dosis wird auf 2–3 Dosen aufgeteilt. Anschließend wird die Dosis schrittweise um 5–15 mg erhöht, bis die gewünschte Wirkung erreicht ist. Üblicherweise variiert die Dosis zwischen 30 und 60 mg pro Tag. Mögliche Nebenwirkungen der Einnahme von Baclofen – Kraftverlust, niedriger Blutdruck, Ataxie – verschwinden mit der Dosisreduktion. Die Dosierung des Arzneimittels sollte schrittweise reduziert werden: Ein plötzlicher Entzug kann Krampfanfälle und Halluzinationen verursachen. Es liegen keine Studien zur Sicherheit der Anwendung von Baclofen zur Behandlung von Kinderlähmung vor, daher wird es Kindern mit äußerster Vorsicht verschrieben.
Sirdalud (Tizanidin) beeinflusst selektiv die polysynaptischen Bahnen des Rückenmarks. Es reduziert die Produktion von Aminosäuren mit erregender Wirkung und verringert dadurch die Frequenz erregender Signale an die Neuronen des Rückenmarks. Hinsichtlich der Wirksamkeit bei der Reduzierung von Hypertonie ähnelt Sirdalud Baclofen, ist jedoch deutlich besser verträglich und zeigt sowohl bei zentraler spastischer Lähmung als auch bei Spinalparalyse positive Ergebnisse. Erwachsenen wird eine Dosierung von bis zu 2 mg pro Tag (aufgeteilt auf 2–3 Dosen) verschrieben, wobei die Tagesdosis anschließend auf 12–14 mg (aufgeteilt auf 3–4 Dosen) erhöht werden kann. Nebenwirkungen können während der Behandlung mit Sirdalud auftreten: leichter Blutdruckabfall, Kraftverlust und Schlafstörungen.
Diazepam (oder Valium) mildert die Wirkung von Gamma-Aminobuttersäure, die eine präsynaptische Signalhemmung und Unterdrückung spinaler Reflexe verursacht. Der Hauptgrund für die geringe Verbreitung von Diazepam ist seine spürbare sedierende Wirkung und die negativen Auswirkungen auf die kognitiven Funktionen. Die Anwendung beginnt mit einer Dosierung von 2 mg pro Tag und wird schrittweise auf 60 mg pro Tag erhöht, verteilt auf 3-4 Dosen.
Zu den Muskelrelaxantien, die bei der Behandlung spinaler Spastiken wirksam sind, gehört Dantrolen. Das Medikament beeinflusst den Aktin-Myosin-Komplex, der für die Muskelkontraktion verantwortlich ist. Da Dantrolen die Freisetzung von Kalzium aus dem sarkoplasmatischen Retikulum verringert, verringert sich die Kontraktilität des Muskelgewebes. Dantrolen greift nicht in die spinalen Mechanismen ein, die die Muskelspannung regulieren. Es hat eine stärkere Wirkung auf die Muskelfasern und reduziert die Manifestation phasischer Reflexe stärker und tonischer Reflexe teilweise.
Es erzielt die besten Ergebnisse bei der Behandlung von Spastik zerebraler Genese (Lähmung nach Schlaganfall, Zerebralparese) und hat wenig Einfluss auf die kognitiven Funktionen. Das Medikament wird in einer niedrigen Dosis von 25–50 mg pro Tag eingenommen und anschließend auf 100–125 mg erhöht. Folgen und Komplikationen im Zusammenhang mit der Einnahme von Dantrolen: Kraftverlust, Schwindel und Übelkeit, Störungen des Verdauungssystems. In 1 von 100 Fällen zeigen Patienten Anzeichen einer Leberschädigung, daher sollte Dantrolen bei chronischen Lebererkrankungen nicht eingenommen werden. Das Medikament ist auch bei Herzinsuffizienz kontraindiziert.
Die Wahl des Medikaments zur Behandlung spastischer Lähmungen wird durch den Ursprung der Erkrankung, den Grad der Muskelhypertonie und den spezifischen Wirkmechanismus des jeweiligen Medikaments bestimmt.
Zusätzlich zu den beschriebenen Medikamenten wird die Einnahme allgemein stärkender Medikamente empfohlen: B-Vitamine, Stoffwechselmedikamente und Medikamente, die die Durchblutung aktivieren.
Physiotherapeutische Behandlung
Beliebte physiotherapeutische Methoden sind die lokale Anwendung von Kälte oder Wärme sowie die elektrische Stimulation peripherer Nerven.
Lokale Kälteanwendung hilft, hypertrophe Sehnenreflexe zu reduzieren, die Gelenkbeweglichkeit zu erhöhen und die Funktion der Antagonistenmuskulatur zu verbessern. Eine kalte Kompresse reduziert den Hypertonus kurzfristig, höchstwahrscheinlich aufgrund einer vorübergehenden Abnahme der Empfindlichkeit der Hautrezeptoren und einer verlangsamten Nervenleitung. Ein ähnliches Ergebnis wird durch die Verwendung von Lokalanästhetika erzielt. Für eine optimale Wirkung werden Eisanwendungen 20 Minuten oder länger angewendet. Die Behandlungsdauer beträgt 15–20 Behandlungen.
Lokale Wärmeanwendung zielt auch darauf ab, den Muskelhypertonus zu reduzieren. Zu diesem Zweck werden Paraffin- oder Ozokerit-Anwendungen verwendet, die in Form von breiten Streifen, Handschuhen und Socken angewendet werden. Zu diesem Zeitpunkt muss der Patient eine Position einnehmen, in der der betroffene Muskel so weit wie möglich gedehnt wird. Die Temperatur von Ozokerit oder Paraffin sollte zwischen 48 und 50 Grad liegen, die Anwendungsdauer beträgt 15 bis 20 Minuten. Der Therapieverlauf umfasst 15 bis 20 Anwendungen. Bei der Durchführung von Wärmeanwendungen bei Patienten, die zu Bluthochdruck neigen, sollte der Blutdruck überwacht werden.
Elektrostimulation wurde erstmals vor langer Zeit – vor etwa 150 Jahren – zur Behandlung von Spastik eingesetzt. Heutzutage werden oberflächliche, subkutane und epidurale Elektrodenapplikationen sowie Implantationen zur Linderung von Muskelhypertonie eingesetzt. Die elektrische Stimulation peripherer Nerven wird üblicherweise bei spastischer Beinlähmung im Stehen, beim Gehen und bei körperlicher Aktivität eingesetzt. Oberflächliche Elektrostimulation ist wirksam bei der Behandlung von Patienten, die nach einem Schlaganfall gelähmt sind.
Der Mechanismus der elektrischen Stimulation beruht auf der Modulation von Neurotransmittern in bestimmten Bereichen. Der Tonus nimmt kurzzeitig – buchstäblich für mehrere Stunden – ab. Die Parameter der elektrischen Stimulation werden unter Berücksichtigung der Ursachen, des Ortes der Läsion und des Lähmungsstadiums ausgewählt. Bei Spastik wird Elektrogymnastik der Antagonisten empfohlen: Die Einwirkung auf spastische Muskeln kann zu einem noch stärkeren Tonus führen. Die elektrische Stimulation erfolgt üblicherweise mit hochfrequenten Strömen: Niederfrequente Ströme reizen die Haut stark und können schmerzhaft sein, was auch den Hypertonus erhöht.
Massage
Eine spezielle Massage bei spastischer Lähmung zielt darauf ab, die hypertonen Muskeln so weit wie möglich zu entspannen. Daher beschränken sich die Massagetechniken auf Streichen, Schütteln und sanftes, langsames Aufwärmen. Scharfe, schmerzhafte Techniken hingegen führen zu einem erhöhten Tonus. Neben der klassischen Massage werden auch Punktmassagetechniken angewendet. Die Bremstechnik dieser Massageart besteht aus einer allmählichen Erhöhung des Fingerdrucks auf bestimmte Punkte. Ist der optimale Druck erreicht, wird der Finger eine Zeit lang gehalten und anschließend der Druck allmählich reduziert, bis er vollständig aufhört. Die Behandlung jedes Punktes dauert 30 bis 90 Sekunden.
Physiotherapie
Die Physiotherapie bei spastischer Lähmung besteht aus Übungen zur Muskelentspannung, zur Unterdrückung pathologischer Synkinesien und zur Entwicklung der Dehnbarkeit der betroffenen Muskeln. Moderate Muskeldehnung hilft, den Hypertonus vorübergehend zu reduzieren und die Gelenkbeweglichkeit zu erhöhen. Der Wirkmechanismus dieser Übungen ist noch nicht vollständig erforscht. Wahrscheinlich beeinflussen die Übungen die mechanischen Eigenschaften des Muskel-Sehnen-Apparates und die Modulation der synaptischen Übertragung. Da der Tonus kurzzeitig abnimmt, versucht der Kinesiotherapeut, diese Zeit optimal zu nutzen, um an den durch die Spastik eingeschränkten Bewegungen zu arbeiten.
Die physikalische Therapie bei spastischer Lähmung hat ihre eigenen Besonderheiten:
- die Sitzung muss unterbrochen werden, wenn der Muskeltonus über das Ausgangsniveau steigt;
- um Synkinesien zu vermeiden, wird an kombinierten Bewegungen, bei denen mehr als ein Gelenk beteiligt ist, nur gearbeitet, wenn klare Bewegungen in einem einzelnen Gelenk erreicht wurden (zuerst wird es in eine Richtung und Ebene entwickelt, im nächsten Schritt - in verschiedene);
- Umsetzung der Regel der "partiellen" Volumina - die Arbeit am Muskel wird im Anfangsstadium im Bereich kleiner Amplituden durchgeführt, und erst wenn der Muskel ausreichend stark ist, wird die Amplitude auf das physiologische Niveau erhöht;
- der möglichst frühe Übergang vom „abstrakten“ Muskelaufbau zur Entwicklung alltagsrelevanter Fähigkeiten;
- Während der Übungen wird die Atmung überwacht: Sie sollte gleichmäßig, ohne Schwierigkeiten oder Kurzatmigkeit sein.
Wenn Sie dem Patienten Übungen des Autogenen Trainings beibringen und diese Elemente in eine therapeutische Übungsstunde einbauen, wird das beste Ergebnis erzielt.
Homöopathie
Homöopathische Präparate sind in der Erholungsphase empfehlenswert. Sie helfen, die Funktion der Nervenimpulsleitung und die Funktion der Beckenorgane wiederherzustellen. Die Präparate werden von einem Homöopathen unter Berücksichtigung des Zustands des Patienten, des Ausmaßes der Schädigung und der Begleiterkrankungen ausgewählt.
Die am häufigsten verwendeten Medikamente sind:
- Lachesis aktiviert die Blutzirkulation im Gehirn. Das Medikament ist am wirksamsten bei Schlaganfällen mit linksseitiger Manifestation.
- Bothrops aktiviert außerdem die Hirndurchblutung, bekämpft Blutgerinnsel und ist bei rechtsseitiger Lähmung wirksam.
- Lathyrus sativus ist bei spastischem Gang angezeigt, wenn beim Gehen die Knie aneinanderstoßen und es nicht möglich ist, eine Position mit gekreuzten oder im Gegenteil ausgestreckten Beinen in sitzender Position einzunehmen.
- Nux vomica verbessert die Leitfähigkeit von Gehirnimpulsen und zeigt spürbare Ergebnisse bei spastischer Lähmung der Beine. Wirkt sich positiv auf die Funktion der Beckenorgane aus.
Chirurgische Behandlung
Wenn andere Behandlungen erfolglos geblieben sind, wird die Möglichkeit einer chirurgischen Erweiterung der motorischen Funktionen erwogen. Bei der Entscheidung für einen chirurgischen Eingriff werden viele Faktoren berücksichtigt:
- Wie lange ist das Nervensystem bereits betroffen? Eine chirurgische Behandlung wird erst dann in Betracht gezogen, wenn alle Methoden zur Wiederherstellung der motorischen Funktionen ausgeschöpft sind (frühestens sechs Monate nach einem Schlaganfall und ein bis zwei Jahre nach einer Hirnverletzung).
- Spastik kann zweierlei Natur haben – dynamisch oder statisch. Bei dynamischer Spastik erhöht sich der Tonus bei Bewegungen (z. B. beim Übereinanderschlagen der Beine beim Gehen bei Zerebralparese). Die statische Natur der spastischen Lähmung entsteht durch einen anhaltenden Anstieg des Muskeltonus, der zur Bildung von Kontrakturen führt, die sowohl in Ruhe als auch in Bewegung gleichermaßen ausgeprägt sind. Manchmal ist es notwendig, Nervenblockaden mit Anästhetika anzuwenden, um die Art der Spastik zu bestimmen.
- Empfindlichkeit der Extremität, Grad ihrer Deformation. Eine Operation an einem Arm oder Bein führt möglicherweise nicht zu Ergebnissen, wenn der Patient offensichtliche Beeinträchtigungen in der Fähigkeit aufweist, zielgerichtete Bewegungen auszuführen.
- Schäden am Bewegungsapparat (Frakturen, Luxationen, Arthritis). Werden diese Bedingungen nicht berücksichtigt, ist die günstige Prognose eines chirurgischen Eingriffs möglicherweise nicht gerechtfertigt.
Hausmittel
Die traditionelle Medizin verfügt über eigene Mittel zur Behandlung von Spastiken:
- Ein Teelöffel zerkleinerte Pfingstrosenwurzeln wird mit einem Glas kochendem Wasser aufgebrüht. Nach einer Stunde ist der Sud fertig. Er wird gefiltert und bis zu fünfmal täglich 1 Esslöffel getrunken.
- Lorbeeröl. Zur Zubereitung 30 g Lorbeerblätter mit 200 g Sonnenblumenöl übergießen und an einem warmen Ort 55–60 Tage ziehen lassen. Anschließend das Öl filtern und zum Kochen bringen. Die betroffenen Stellen täglich mit diesem Öl behandeln.
- Grüner Tee hilft, wenn er richtig aufgebrüht wird, bei der Genesung von einer Lähmung infolge eines Schlaganfalls.
- Zum Baden wird ein Sud aus Hagebuttenwurzeln zubereitet. Eine vollständige Badekur umfasst 20-30 Anwendungen.
Gelähmte Muskeln werden mit einer flüchtigen Salbe behandelt. Die Zubereitung ist ganz einfach: Alkohol und Sonnenblumenöl werden im Verhältnis 1:2 gemischt. Auch Äther kann zur Herstellung der Salbe verwendet werden, allerdings ist zu beachten, dass dieser leicht Feuer fängt.
 [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ]
[ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ]
Kräuterbehandlung
- Der Kräutertee wird aus Kamillenblüten (2 Teile), Zitronenmelisse (1 Teil), Hopfenzapfen (1 Teil) und Wermutwurzel (1 Teil) zubereitet. Trinken Sie dreimal täglich 100 ml des Aufgusses eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten.
- Aufguss aus Arnikablüten. Dazu 1 Teelöffel Blüten mit einem Glas kochendem Wasser übergießen, kurz ziehen lassen und abseihen. Dreimal täglich 1 Esslöffel des Aufgusses trinken. Arnika reduziert die Erregbarkeit und lindert Schmerzen und Krämpfe.
- Weiße Akazienblüten werden zur Herstellung einer Alkoholtinktur verwendet. Die betroffenen Muskeln werden damit eingerieben. Für die Tinktur benötigen Sie 4 Esslöffel Blüten und 200 ml Wodka. Nach einer Woche die Tinktur abseihen und dreimal täglich 1 Teelöffel trinken.
Die Einbeziehung von Volksheilmitteln in den Behandlungskomplex ist nur mit Zustimmung des behandelnden Arztes möglich. Es lohnt sich nicht, in solchen Angelegenheiten unabhängige Entscheidungen zu treffen: Spastische Lähmung ist eine schwere Erkrankung, die einen umfassenden Behandlungsansatz zur Wiederherstellung der motorischen Funktionen erfordert. Wenn Ärzte, Angehörige und der Patient selbst alle Anstrengungen unternehmen, ist in vielen Fällen eine vollständige Heilung oder teilweise Wiederherstellung verlorener Funktionen durchaus möglich.

