
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Studie identifiziert genetischen Schalter, der Leukämiezellen hilft, Chemotherapie zu umgehen
Zuletzt überprüft: 18.08.2025
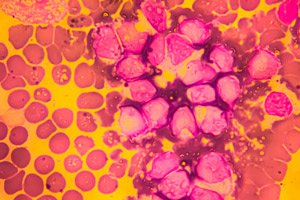 ">
">Wissenschaftler haben einen molekularen Trick beschrieben, der das häufige Wiederauftreten einer akuten myeloischen Leukämie (AML) nach der Behandlung ermöglicht. Eine neue Arbeit in Blood Cancer Discovery zeigt, dass während eines Rückfalls bei manchen Patienten ein „alternatives Programm“ des RUNX1-Gens aktiviert wird: Es ist die RUNX1C-Isoform, die stark ansteigt, BTG2 auslöst und Leukämiezellen in einen Ruhezustand versetzt, in dem Chemotherapeutika nahezu wirkungslos sind. Durch Blockierung von RUNX1C (mit Antisense-Oligonukleotiden) und gleichzeitiger Gabe einer Standard-Chemotherapie konnten die Forscher die Zellen „aufwecken“ und ihre Empfindlichkeit gegenüber der Behandlung erhöhen – in Kulturen und bei Mäusen.
Hintergrund der Studie
Akute myeloische Leukämie (AML) ist eine Erkrankung mit Rückfällen: Selbst nach erfolgreicher Induktionschemotherapie erleidet ein erheblicher Anteil der Patienten einen Rückfall. Eine häufige Erklärung ist das „Verstecken“ einiger Zellen in einem Ruhezustand (Quieszenz), der charakteristisch für Leukämiestammzellen (LSCs) ist. Während sich teilende Blasten absterben, überleben langsame und ruhende Klone den Verlauf und bilden den Tumor neu. Das Verständnis der molekularen Schalter dieses Ruhezustands ist der Schlüssel zur Überwindung von Arzneimittelresistenzen.
RUNX1 spielt eine zentrale Rolle in der transkriptionellen Regulation der Hämatopoese – es handelt sich jedoch nicht um ein einzelnes Protein, sondern um eine Familie von Isoformen, die aus alternativen Promotoren und Spleißen entstehen. Beim Menschen wird die RUNX1C-Isoform vom „distalen“ P1-Promotor kodiert, während RUNX1A/1B vom „proximalen“ P2-Promotor kodiert werden; die Verteilung der Isoformen hängt vom Entwicklungsstadium und Zelltyp ab. Die Zusammensetzung der Isoformen kann das Zellverhalten radikal verändern – von der Aufrechterhaltung der Stammzellstruktur bis hin zu onkogenen Eigenschaften –, doch der spezifische Beitrag von RUNX1C zum AML-Rückfall und zur Chemoresistenz ist unklar.
Parallel dazu häuften sich Daten zur Familie der antiproliferativen Proteine BTG/Tob (insbesondere BTG2), die an den CCR4-NOT-Komplex binden und die „Dehydratation“ von Matrix-RNAs (Deadenylierung) beschleunigen, wodurch deren Stabilität verringert und die Proteinsynthese insgesamt unterdrückt wird. Im Immunsystem sind es BTG1/BTG2, die zur Aufrechterhaltung der Zellruhe beitragen; es ist logisch anzunehmen, dass ähnliche Mechanismen Krebszellen „einschläfern“ und sie so vor Zytostatika schützen können. Ein direkter Zusammenhang zwischen RUNX1-Isoformen und BTG2 und dem ruhenden Phänotyp bei AML blieb jedoch bis vor kurzem eine Hypothese.
Eine weitere Lücke ist methodischer Natur. Die meisten Expressionsstudien bei AML berücksichtigen die Gesamtgenkonzentrationen, ohne zwischen Isoformen zu unterscheiden, und analysieren selten gepaarte Proben aus der Zeit vor der Behandlung und dem Rückfall bei denselben Patienten. Ein solches Design ist entscheidend, wenn der Rückfall nicht durch „Gengewinn“, sondern durch Promotor-/Isoformwechsel vor dem Hintergrund epigenetischer Veränderungen ausgelöst wird. Um diese Lücke zu schließen, müssen Zielmoleküle für eine isoformspezifische Therapie (z. B. RNA-gerichtete Oligonukleotide) gefunden werden, die ruhende Zellen „aufwecken“ und für eine Chemotherapie anfällig machen können.
Vor diesem Hintergrund untersucht eine neue Arbeit in Blood Cancer Discovery, ob rezidivierte AML einen epigenetischen „Klick“ in RUNX1 mit einer Verschiebung in Richtung RUNX1C aufweist und ob RUNX1C und BTG2 eine Achse bilden, die Zellen in den Ruhezustand versetzt und die Arzneimittelresistenz erhöht. Die Autoren verwenden gepaarte „Vor-Therapie-/Rückfall“-Proben, RNA-Isoformanalysen, funktionelle Tests und isoformspezifische Antisense-Oligonukleotide – nicht nur, um die Ruhesignatur zu beschreiben, sondern auch, um ihre Reversibilität und pharmakologische Anfälligkeit zu testen.
Wie sind wir dazu gekommen?
Die Autoren wählten einen ungewöhnlichen Ansatz: Sie verglichen Leukämieproben derselben Patienten vor und nach dem Rückfall und analysierten RNA-Isoformen und nicht nur die gesamte Genexpression. Dieses gepaarte Design zeigte, dass sich bei einem Wiederauftreten der Krankheit nicht nur der RUNX1-Spiegel ändert, sondern auch das Verhältnis seiner Isoformen – RUNX1C steigt an. Parallel dazu überprüfte das Team die Mechanismen: Sie identifizierten einen „Schalter“ auf der DNA (Methylierung der regulatorischen Region von RUNX1), das Ziel von RUNX1C – das BTG2-Gen – und die funktionellen Folgen – Zellruhe und Arzneimittelresistenz.
- Die Isoform ist wichtig. RUNX1 existiert in mehreren Varianten; ihr Ungleichgewicht wird seit langem bei hämatologischen Erkrankungen vermutet, aber die Rolle von RUNX1C bei AML-Rückfällen wurde in klinischem Material eindeutig nachgewiesen.
- Epigenetischer „Klick“. Bei einem Rückfall erscheint eine Methylmarkierung in der RUNX1-Regulationszone, die die Tumorzellen dazu veranlasst, auf die Produktion von RUNX1C umzuschalten.
- RUNX1C→BTG2-Achse. RUNX1C aktiviert BTG2, einen bekannten Wachstumshemmer, der transkriptionelle und translationale Prozesse hemmt und einen ruhenden Phänotyp fördert. In diesem Modus teilen sich Zellen kaum – und „rutschen“ unter Chemotherapie durch.
Was die Experimente zeigten
- Bei Patienten (Omics): In gepaarten Proben vor der Therapie und beim Rückfall war RUNX1C durchgängig erhöht; BTG2 und Ruhesignaturen stiegen gleichzeitig an.
- In vitro: Durch die erzwungene Expression von RUNX1C wurden AML-Zellen weniger empfindlich gegenüber mehreren Chemotherapeutika; durch Knockout/Knockdown von RUNX1C wurde die Empfindlichkeit wiederhergestellt.
- Bei Mäusen reduzierte die Zugabe eines Anti-RUNX1C-ASO zur Standard-Chemotherapie die Tumorlast: Die Zellen „erwachten aus dem Winterschlaf“, begannen sich zu teilen – und wurden anfällig für die Medikamente.
Warum ist das wichtig?
Das klassische Bild eines AML-Rückfalls zeigt, dass klonale Zellen die Behandlung „überleben“, oft langsam und inaktiv, wobei Zytostatika nur schwach reizend wirken. Die neue Arbeit identifiziert einen spezifischen molekularen Hebel dieser Inaktivität – die RUNX1C→BTG2-Achse – und zeigt, dass diese auf der Ebene der RNA-Isoformen pharmakologisch optimiert werden kann. Dies stellt einen Wechsel von der Strategie „Töte die sich schnell teilenden Zellen“ hin zu einer Strategie „Weck sie auf und töte sie“ dar.
Was kann dies in der Praxis ändern?
- Neues Ziel: RUNX1C als therapeutisches Ziel bei rezidivierter/chemoresistenter AML. Antisense-Oligonukleotid (ASO) oder andere RNA-zielgerichtete Technologien als Ansatz.
- Kombinationen aus „ASO + Chemo“. Die Idee besteht darin, den Zyklus zu synchronisieren: die Zellen aus der Ruhe zu holen und sie in der Phase maximaler Verletzlichkeit zu behandeln.
- Auswahlbiomarker: RUNX1C/BTG2-Erhöhung und RUNX1-Regulatormethylierung bei Rückfall sind Kandidaten für die Patientenstratifizierung und Risikoüberwachung.
Kontext: Was wir bereits über RUNX1 und BTG2 wussten
- RUNX1 ist ein wichtiger Transkriptionsfaktor der Hämatopoese; in der Onkohämatologie ist es paradox: Es kann sich als Suppressor oder als Onkogen verhalten – Kontext und Isoform entscheiden viel.
- BTG2 ist ein Wachstums-/Differenzierungssuppressor und Stresssignalmediator; seine Aktivierung führt häufig zu einer Verlangsamung des Zellzyklus und zu einer „Ruhe“ – was unter normalen Bedingungen von Vorteil ist und bei Tumoren hilft, den Stress der Therapie zu überleben.
Zu beachtende Einschränkungen
- Der Weg in die Klinik. Die ASO-Richtung für die Onkohämatologie ist gerade erst im Entstehen; es sind Sicherheits-/Anwendungsstudien und präzise Kombinationsschemata mit Chemotherapie erforderlich.
- Heterogenität der AML. Nicht alle Patienten erleiden einen Rückfall über die RUNX1C→BTG2-Achse. Um diejenigen auszuwählen, bei denen der „Schalter“ wirklich eingeschaltet ist, sind validierte Panels erforderlich.
- Nachweis der Ergebnisse: Bisher anhand von Zellen/Mäusen und molekularer Profilierung von Patienten gezeigt; um über den Überlebensvorteil sprechen zu können, sind klinische Studien erforderlich.
Wie geht es weiter?
- Entwicklung von ASO für RUNX1C und Wake-and-Kill-Protokollen mit Chemotherapie-Phasen.
- Klinische Tests von Biomarkern (RUNX1C, BTG2, RUNX1-Methylierung) zur Früherkennung ruhender Resistenzen.
- Die Isoform-Onkologie geht über AML hinaus: Sie prüft, ob ähnliche Isoform-„Schalter“ in anderen Blutkrebsarten und soliden Tumoren verborgen sind.
Quelle: Han C. et al. Eine Isoform-spezifische RUNX1C-BTG2-Achse steuert die Ruhe und Chemoresistenz von AML. Blood Cancer Discovery, 2025. https://doi.org/10.1158/2643-3230.BCD-24-0327
