
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
„Trojanische Mikrobe“: Bakterien verstecken onkolytische Viren vor dem Immunsystem und schleusen sie direkt in Tumore
Zuletzt überprüft: 23.08.2025
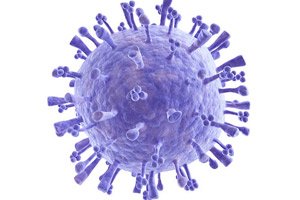 ">
">Onkolytische Viren können Krebszellen abtöten, sind aber oft machtlos gegen … unsere Immunität: Neutralisierende Antikörper fangen Viren im Blut ab und verhindern, dass sie den Tumor erreichen. Ein Team von Columbia Engineering hat einen cleveren Workaround vorgeschlagen: Das Virus wird in einem Bakterium versteckt, das den Tumor selbst findet und besiedelt. In Nature Biomedical Engineering stellten sie die CAPPSID-Plattform vor – „Coordinated Activity of Prokaryote and Picornavirus for Safe Intracellular Delivery“. Das Bakterium Salmonella typhimurium produziert RNA des onkolytischen Virus Senecavirus A (SVA) und setzt sie in der Tumorzelle frei, von wo aus sich das Virus ausbreitet und für zirkulierende Antikörper unsichtbar bleibt. Bei immunkompetenten Mäusen unterdrückte dieser „Trick“ das Tumorwachstum und funktionierte sogar bei bestehender antiviraler Immunität.
Hintergrund der Studie
Onkolytische Viren gelten seit langem als „selbstreplizierende Medikamente“: Sie selektieren Krebszellen, vermehren sich in ihnen und lösen eine Immunreaktion gegen den Tumor aus. Dieser Ansatz weist jedoch eine anhaltende systemische Barriere auf: die Freisetzung. Bei intravenöser Verabreichung werden Viren schnell von neutralisierenden Antikörpern und Elementen des angeborenen Immunsystems abgefangen, einige der Partikel „kleben“ in Leber und Milz, und nur ein kleiner Teil erreicht einen dichten, schlecht durchbluteten Tumor. Daher sind viele klinische Protokolle gezwungen, sich auf intratumorale Injektionen zu beschränken, was das Indikationsspektrum einschränkt und die Behandlung mehrerer Herde erschwert.
Parallel zu Viren entwickelte sich ein weiterer Zweig „lebender“ Antitumormittel – gentechnisch veränderte Bakterien. Abgeschwächte Stämme von Salmonellen, E. coli, Listerien usw. zeigen Tumorotropismus: Sie besiedeln bereitwillig hypoxische Tumorzonen und können als Träger für die lokale Verabreichung von Zytotoxinen, Zytokinen oder genetischen Kassetten dienen. Die bakterielle Therapie wirkt jedoch lokal und ist durch das Ausmaß der Besiedlung begrenzt: Zellen außerhalb der „Bakteriennester“ sind schwer zu erreichen, und Sicherheit und Kontrollierbarkeit unterliegen stets der strengen Kontrolle der Regulierungsbehörden.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Idee, die Stärken beider Welten zu kombinieren, logisch. Bisher gab es Versuche, Viren mit Polymeren abzuschirmen, sie in Trägerzellen (z. B. mesenchymalen Stammzellen) zu verstecken oder Exosomen zu verwenden – all diese Ansätze umgehen teilweise Antikörper, erschweren aber Produktion und Kontrolle. Bakterien sind in der Lage, einen Tumor selbstständig zu finden und die „Fracht“ tief in das Gewebe zu transportieren. Bringt man ihnen bei, das Virus direkt in die Tumorzelle zu schleusen, kann man den systemischen Immun-„Schutzschirm“ umgehen und gleichzeitig den betroffenen Bereich durch die weitere Virusausbreitung über die Kolonie hinaus ausdehnen.
Der Schlüssel zur Translation ist die Sicherheitskontrolle. Ein nacktes onkolytisches Virus in einem Bakterium könnte theoretisch „wild werden“. Deshalb verfügen moderne Plattformen über mehrstufige Sicherungen: Die virale RNA wird nur in der Tumorzelle synthetisiert und freigesetzt, und die vollständige Zusammensetzung der Virionen ist vom „Schlüssel“ abhängig – einer spezifischen Protease oder einem anderen Faktor, den nur das Bakterium liefert. Dadurch bleibt das Virus ein „blinder Passagier“, bis es sein Ziel erreicht; das Immunsystem sieht es nicht im Blutkreislauf; es wird gezielt freigesetzt, und die Wahrscheinlichkeit einer unkontrollierten Verbreitung wird reduziert. Diese Strategie wird in der neuen Arbeit entwickelt und zeigt, dass ein „Kurierbakterium“ ein onkolytisches Picornovirus zuverlässig zu einem Tumor bringen und dort aktivieren kann, wo es wirklich benötigt wird.
So funktioniert es
- Bakterien-Spotter. Der genetisch veränderte S. typhimurium gelangt auf natürliche Weise zum Tumor und kann in Krebszellen eindringen. Im Inneren transkribiert er virale RNA (einschließlich des vollständigen SVA-Genoms) mithilfe spezifischer Promotoren.
- Autolytischer „Auslöser“. Das Bakterium ist so programmiert, dass es im Zytoplasma der Tumorzelle lysiert und gleichzeitig virale RNA und ein Hilfsenzym freisetzt. Das Virus beginnt einen Replikationszyklus und infiziert benachbarte Zellen.
- Sicherheitskontrolle. Das Virus wird weiter modifiziert: Zur Bildung reifer Virionen benötigt es einen Protease-„Schlüssel“ (z. B. die TEV-Protease), der nur vom Bakterium bereitgestellt wird. Dies begrenzt eine unkontrollierte Ausbreitung.
- „Schutzschild“ vor Antikörpern. Während die virale RNA in den Bakterien „verpackt“ ist, wird sie von neutralisierenden Antikörpern im Blut nicht erkannt, was die Übertragung zum Tumor erleichtert.
Was die Experimente zeigten
- In der Kultur: CAPPSID löste eine vollwertige SVA-Infektion und Virusverbreitung unter nicht mit dem Bakterium infizierten Zellen aus (einschließlich der neuroendokrinen Lungenkrebslinien H446).
- Bei Mäusen hemmte die intratumorale und intravenöse Verabreichung von CAPPSID das Tumorwachstum und ermöglichte eine robuste Virusreplikation; in einigen Modellen wurden subkutane SCLC-Tumoren vollständig ausgerottet.
- Immune „Störimmunität“: Das System funktionierte sogar in Gegenwart neutralisierender Antikörper gegen SVA: Die Bakterien lieferten das Genom an den Tumor und das Virus wurde „hinter der Verteidigungslinie“ freigesetzt.
- Kontrolle der Ausbreitung: Die bedingte Abhängigkeit des Virus von einer bakteriellen Protease ermöglichte es ihm, die Anzahl der Infektionszyklen außerhalb der ursprünglichen Zelle zu begrenzen – eine zusätzliche Sicherheitskontrollebene.
Warum dies wichtig ist (und wie es sich von herkömmlichen Ansätzen unterscheidet)
Klassische onkolytische Viren haben zwei Probleme: Antikörper fangen sie im Blut ab, und eine systemische Ausbreitung birgt das Risiko einer Toxizität. Gentechnisch veränderte Bakterien hingegen lieben Tumore, wirken aber lokal und haben Schwierigkeiten, die Peripherie des Neoplasmas zu „erreichen“. CAPPSID vereint die Stärken beider Welten:
- Verabreichung über Bakterien → höhere Chance, den Tumor zu erreichen und Antikörper zu umgehen;
- Virus im Inneren → infiziert benachbarte Zellen und erweitert seinen Wirkungsbereich über die Bakterienkolonie hinaus;
- Eine eingebaute „Sicherung“ in Form eines Virus, das eine bakterielle Protease benötigt, verringert das Risiko einer unkontrollierten Verbreitung.
Technische Details
- Bei Salmonellen wurden die SPI-1/SPI-2-Pathogenitätsinsel-Promotoren rekrutiert, um die Transkription viraler RNA und Lyseproteine (HlyE, φX174 E) zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort präzise zu aktivieren.
- Sie testeten sowohl Replikons (selbstverstärkende, aber nicht verbreitende RNA) als auch SVA in voller Länge, das bei der Ausweitung der Läsion durch erneute Infektion wirksamer war.
- Die TEV-Protease wurde als „externer Schlüssel“ für die Zusammensetzung der Virionen verwendet: Ohne sie „reift das Virus nicht“.
Einschränkungen und Fragen zur zukünftigen Bezugnahme
- Derzeit handelt es sich um eine präklinische Studie: Zellen, immunkompetente Mäuse, eine begrenzte Anzahl von Tumormodellen; orthotope Modelle und GLP-Toxikologie stehen noch aus.
- Es bedarf einer gründlichen Bewertung der Sicherheit der Bakterien bei systemischer Verabreichung und der Widerstandsfähigkeit der „Sicherung“ gegen das Entkommen des Virus durch Mutation (die Autoren legen bereits die Wahl der Einschnittstellen fest, die das Risiko einer Reversion verringern).
- Für eine echte Klinik sind Stämme mit nachgewiesener Sicherheit (z. B. vom Menschen abgeschwächte Salmonellenderivate) und eine durchdachte Kombination mit einer Immuntherapie erforderlich.
Was könnte das morgen bedeuten?
- Neue „lebende Medikamente“ für solide Tumore, bei denen die Verabreichung den größten Engpass darstellt.
- Personalisierung viraler Ziele: SVA zeigt Tropismus für neuroendokrine Tumoren; theoretisch könnte die Plattform für andere onkolytische Picornaviren oder Replikons umfunktioniert werden.
- Reduzierung des Viruspartikelverbrauchs und des Risikos systemischer Nebenwirkungen durch lokale Freisetzung am Infektionsort.
Abschluss
Ingenieure haben die Bakterien in ein „lebendes Kapsid“ verwandelt, das das Virus vor Antikörpern schützt, es zum Tumor transportiert und so den Schlüssel für dessen sichere Einschleusung ins Innere liefert. Bei Mäusen hemmt dies das Tumorwachstum und umgeht die antivirale Immunität. Im nächsten Schritt gilt es, die Sicherheit und Anpassbarkeit der Plattform im Rahmen klinischer Studien zu bestätigen.
Quelle: Singer ZS, Pabón J., Huang H., et al. Engineered bacteria launch and control an oncolytic virus. Nature Biomedical Engineering (online 15. August 2025). doi: 10.1038/s41551-025-01476-8.
