
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Wissenschaftler haben einen Weg gefunden, die Alzheimer-Krankheit mit Antikörpern zu behandeln
Zuletzt überprüft: 30.06.2025
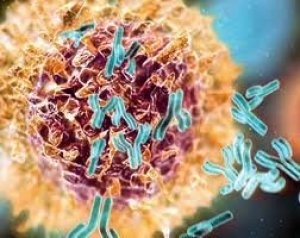 ">
">Forscher haben eine Möglichkeit gefunden, die Alzheimer-Krankheit mithilfe von Antikörpern mit doppelter Spezifität zu behandeln: Eine Hälfte des Antikörpermoleküls umgeht einen Kontrollpunkt zwischen dem Gehirn und einer Blutkapillare, während die andere an ein Protein bindet, das den Tod von Gehirnneuronen verursacht.
Wissenschaftler des Biotechnologieunternehmens Genentech wissen, wie man über die Blutgefäße ins Gehirn gelangt. Auf den ersten Blick kein Problem: Das Gehirn wird über ein dichtes Kapillarnetz mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Doch vor über hundert Jahren entdeckten Physiologen die sogenannte Blut-Hirn-Schranke zwischen Gehirn und Blutkreislauf. Ihre Funktion besteht darin, die biochemische Konstanz im Gehirn aufrechtzuerhalten: Zufällige Veränderungen (beispielsweise der Ionenzusammensetzung oder des pH-Werts des Blutes) dürfen die Gehirnfunktion nicht beeinträchtigen; Neurotransmitter, die andere Organsysteme steuern, dürfen nicht ins Gehirn gelangen; zumal das Gehirn für die meisten großen Moleküle wie Antikörper und bakterielle Toxine (ganz zu schweigen von den Bakterien selbst) verschlossen ist. Die Zellen der Kapillarwände im Gehirn verfügen über extrem dichte Verbindungen und eine Reihe weiterer Merkmale, die das Gehirn vor unerwünschtem Eindringen schützen. Infolgedessen ist die Konzentration derselben Antikörper hier tausendmal geringer als im Blutkreislauf.
Für die Behandlung vieler Krankheiten ist es jedoch wichtig, Medikamente direkt ins Gehirn zu transportieren. Handelt es sich bei diesem Medikament um so große Proteine wie Antikörper, verringert sich die Wirksamkeit der Behandlung erheblich. Mittlerweile setzen viele Hoffnungen auf künstliche Antikörper, auch in der Alzheimer-Forschung. Diese Krankheit geht mit der Bildung von Amyloidmassen in Neuronen einher – also einem „Sediment“ falsch gepackter Proteinmoleküle, das Nervenzellen zerstört. Unter den Proteinen, die für die Amyloide bei Alzheimer verantwortlich sind, ist die β-Sekretase 1 das bekannteste und wird am häufigsten als Therapieziel gewählt.
Um die Blut-Hirn-Schranke zu durchbrechen, entwickelten die Forscher bidirektionale Antikörper. Ein Teil des Moleküls erkannte das Enzym β-Sekretase, der andere das Protein Transferrin in den Gefäßwänden. Letzteres ist ein Rezeptor, der für den Fluss von Eisenionen ins Gehirn verantwortlich ist. Nach der Theorie der Wissenschaftler hefteten sich die Antikörper an Transferrin, das sie ins Gehirn übertrug: So blieb die Barriere zwischen Gehirn und Blutkreislauf sozusagen „im Regen stehen“.
Gleichzeitig mussten die Forscher ein weiteres Problem lösen, diesmal im Zusammenhang mit den Antikörpern selbst. Die Stärke, mit der Antikörper an ihr Zielmolekül – das Antigen – binden, wird als Affinität bezeichnet. Normalerweise gilt: Je höher die Affinität, desto besser der Antikörper. Aus medizinischer Sicht sind die Antikörper mit der stärksten Bindung auch die wirksamsten. In diesem Fall mussten die Wissenschaftler jedoch die Bindungsstärke der erzeugten Antikörper an Transferrin reduzieren, da sie sonst fest an den Träger binden und an der Schwelle stecken bleiben würden. Die Strategie zahlte sich aus: In Experimenten an Mäusen sank die Menge amyloidogener Proteine im Gehirn der Tiere bereits einen Tag nach der Injektion dieser Antikörper um 47 %.
In ihrer Arbeit widersprachen die Forscher den Regeln, die besagen, dass Antikörper streng spezifisch sein und eine hohe Affinität aufweisen müssen, d. h. nur ein Zielmolekül sehr fest binden dürfen. Doch gerade schwach bindende Antikörper mit mehreren Spezifitäten können nicht nur bei der Behandlung der Alzheimer-Krankheit, sondern auch bei der Krebstherapie hilfreich sein. Krebszellen tragen Proteine auf ihrer Oberfläche, die von Antikörpern erkannt werden können. Dieselben Proteine werden jedoch auch von anderen Zellen produziert, weshalb Antikörper gegen Krebszellen oft auch gesunde Zellen abtöten. Multispezifische Antikörper könnten eine für Krebszellen charakteristische Kombination von Oberflächenproteinen erkennen, und eine Kombination solcher Proteine würde es Antikörpern ermöglichen, nur an Krebszellen fest zu binden, nicht aber an normale Zellen, an denen sie einfach nicht haften würden.
Skeptiker konkurrierender Unternehmen argumentieren, dass die von Genentech entwickelten Antikörper aufgrund ihrer geringen Spezifität nicht klinisch eingesetzt werden würden, da hierfür riesige Mengen an Menschen injiziert werden müssten. Die Autoren behaupten jedoch, dass dies nicht nötig sein wird: Unsere Antikörper halten viel länger als die von Mäusen, und die überschüssigen Antikörper, die den Versuchstieren injiziert werden mussten, seien schlicht eine Besonderheit des „Maus“-Systems.

 [
[