
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Arten von Zwangsvorstellungen: zwanghaft, emotional, aggressiv
Facharzt des Artikels
Zuletzt überprüft: 04.07.2025
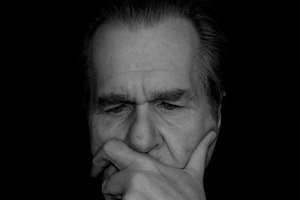
Wir alle haben uns mehr oder weniger auf Gedanken oder Handlungen fixiert, die uns im Moment wichtig erschienen, Angst oder Irritation verursachten. Sie werden normalerweise mit einem bevorstehenden schicksalhaften Ereignis oder einer Situation in Verbindung gebracht, die unser Leben radikal verändern kann. Daher ist die Besessenheit von solchen Gedanken durchaus verständlich. Eine Obsession ist ein untypischer Gedanke oder eine Idee, die einen Menschen gegen seinen Willen belagert, periodisch und unfreiwillig bei klarem Bewusstsein auftritt und von der er sich selbst nicht durch seine eigene Willenskraft befreien kann. Manchmal veranlassen diese Gedanken eine Person zu zwanghaften Handlungen (Zwängen) oder führen zu irrationalen Ängsten (Phobien), die nicht logisch begründet werden können. Diese Manifestationen können Obsessionen ergänzen, werden aber in der modernen Psychiatrie gesondert betrachtet.
Das Bewusstsein der Person bleibt klar, das logische Denken leidet nicht, daher verursacht die Fixierung auf obsessive, ungesunde Gedanken, die seinem Bewusstsein fremd sind, und die Unfähigkeit, sie loszuwerden, beim Patienten negative Emotionen bis hin zur Entwicklung von Depressionen und Neurosen.
Epidemiologie
Statistiken zeigen, dass etwa 1–2 % der Weltbevölkerung an Zwangsstörungen leiden. Es gibt jedoch auch Neurotiker, Schizophrene, Menschen mit anderen psychischen Störungen, die unter Zwangsgedanken leiden, und Menschen, die keinen Arzt aufsuchen, weil sie sich nicht als krank betrachten, nur weil sie von Zwangsgedanken geplagt werden. Viele Forscher behaupten, dass diese Krankheit sehr häufig ist und nach Phobien, Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen und klinischen Depressionen die zweithäufigste Erkrankung darstellt.
Im Allgemeinen besteht bei Patienten mit Zwangsstörungen ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis. In der Regel sind die meisten Erstbetroffenen, die über Zwangsstörungen klagen, Kinder, häufiger in der Adoleszenz (über 10 Jahre), und junge Menschen im aktiven Arbeitsalter. Fälle der Erkrankung bei älteren Menschen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Bei Kindern überwiegen männliche Patienten, Frauen erkranken meist im Alter von über 20 Jahren.
Ursachen zwanghaftes Verhalten
Die Ätiologie des Auftretens des Zwangssyndroms ist derzeit noch nicht vollständig geklärt. Es tritt als eigenständige Störung auf und wird häufig im Symptomkomplex anderer psychischer und neurologischer Erkrankungen (Schizophrenie, Epilepsie, Neurose, Persönlichkeitsstörungen, Enzephalitis) beobachtet, deren ätiologische Faktoren ebenfalls noch erforscht werden. Es gibt noch viele „weiße Flecken“ in den Mechanismen des Prozesses höherer Nervenaktivität, jedoch gibt es mehrere durch die Forschung unterstützte Theorien, die die Entstehung von Obsessionen erklären.
Risikofaktoren
Risikofaktoren für die Entstehung von Zwangsgedanken unterschiedlicher Art haben biologische, psychologische und soziologische Ursachen.
Zur ersten Gruppe gehören organische Erkrankungen des Zentralnervensystems, seine morphologischen und funktionellen Merkmale, Störungen des Neurotransmittergleichgewichts, Merkmale des autonomen Nervensystems, bestimmte Erbanlagen und zurückliegende Infektionen.
Letztere hängen mit konstitutionellen und persönlichen Merkmalen, Akzentuierungen, Widersprüchen zwischen Bestrebungen und Möglichkeiten, dem Einfluss von Kindheitserlebnissen und -eindrücken, psychotraumatischen Situationen, Erregungsträgheit und Hemmungsinstabilität auf das Seelenleben und Verhalten zusammen. Menschen mit hoher Intelligenz, ausgeprägter Sturheit, neigen zu Angstzuständen, Zweifeln und übermäßiger Detailliertheit und haben das Risiko, eine Zwangsstörung zu entwickeln.
Soziologische Gründe hängen mit verschiedenen Konfliktsituationen, übermäßig strenger Erziehung und situativen Widersprüchen zwischen den Vorstellungen „wie es sein sollte“ und „wie man es haben möchte“ zusammen.
Pathogenese
Die Pathogenese wird dementsprechend auch vorerst hypothetisch betrachtet und hat viele Theorien. Die bekanntesten davon, die von der modernen Medizin anerkannt werden und zumindest teilweise das Wesen der Prozesse erklären, sind die folgenden:
- Die Tiefenpsychologie sieht die Ursachen von Obsessionen in unbewussten sexuellen Erfahrungen in der Kindheit (nach Freud); im psychologischen Widerspruch zwischen dem Wunsch nach Macht, Macht und dem Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit (nach Adler) und unterbewussten Komplexen (nach Jung). Diese Theorien erklären das Auftreten des Zwangssyndroms bei psychogenen Störungen, die biologischen Ursachen werden jedoch nicht aufgedeckt.
- Die Anhänger der Schule des Akademiemitglieds IP Pavlov entwickelten seine Theorie, dass die Pathogenese von Zwangszuständen dem Mechanismus der Entwicklung von Delirium ähnelt, d. h. beiden Prozessen liegt eine ungewöhnliche Trägheit der Erregung zugrunde, gefolgt von der Entwicklung einer negativen Induktion. Später betrachteten sowohl Pavlov selbst als auch viele seiner Schüler den Einfluss einer extremen Hemmung, die sich in der Zone der inerten Erregung entwickelt, sowie die gleichzeitige Abwicklung beider Prozesse als eines der Hauptglieder. Die kritische Haltung des Einzelnen gegenüber Zwangsvorstellungen wurde mit der im Vergleich zum Delirium geringen Sättigung schmerzhafter Erregung und dementsprechend negativer Induktion erklärt. Später wurde in den Arbeiten von Vertretern der Schule dieser Richtung festgestellt, dass Zwangsgedanken, die dem Charakter des Subjekts diametral entgegengesetzt sind, mit einer ultraparadoxen Hemmung verbunden sind, wenn eine Erregung der für absolut polare Ansichten verantwortlichen Gehirnzentren auftritt. Es wurde festgestellt, dass im Verlauf des ständigen Kampfes eines Individuums mit Zwangszuständen Prozesse in der Großhirnrinde geschwächt werden und Patienten mit Zwangsstörungen eine Asthenie entwickeln, die durch eine Behandlung reversibel ist. Eine Ausnahme bilden Personen mit psychasthenischer Konstitution. Die Theorie der Vertreter dieser Schule spiegelt die moderne Neuromediatorentheorie wider und beschreibt Schäden an Gehirnstrukturen auf organismischer Ebene, die in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts zugänglich waren. Dennoch gibt diese Theorie, die die Aktivität der höheren Gehirnregionen während Zwangsstörungen recht klar beschreibt, keinen Hinweis auf den Ursprung dieser pathologischen Prozesse.
- Moderne Ansichten spiegeln Neurotransmitter-Theorien wider.
Serotonin (am umfassendsten) – verbindet das Auftreten von Zwangszuständen mit einer Störung der Interaktion zwischen dem orbitofrontalen Teil der grauen Substanz des Gehirns und den Basalganglien. Hypothetisch gesehen erfolgt bei Personen mit Zwangssymptomen die Wiederaufnahme von Serotonin intensiver, was zu einem Serotoninmangel im synaptischen Spalt führt, wodurch einige interneuronale Übertragungen ausbleiben. Die Serotonintheorie wird durch die Wirksamkeit von Medikamenten der SSRI-Klasse (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) bei der Behandlung von Zwangsstörungen bestätigt. Sie steht auch in guter Übereinstimmung mit der Theorie der hSERT-Genmutation und erklärt das Auftreten von Zwangszuständen neurotischer Natur sowie bei Persönlichkeitsstörungen und teilweise bei Schizophrenie. Sie bringt jedoch keine vollständige Klarheit über den Ursprung dieser Pathologie.
Dopamin (beschreibt einen möglichen Sonderfall) – Es wurde festgestellt, dass Schizophrene und Menschen mit Zwangsstörungen einen erhöhten Dopaminspiegel, einen Neurotransmitter des Glücks, in den Basalganglien aufweisen. Neurobiologen haben außerdem festgestellt, dass die Dopaminkonzentration bei jedem Menschen mit angenehmen Erinnerungen ansteigt. Diese beiden Faktoren bilden die Grundlage der Theorie und legen nahe, dass manche Patienten die Dopaminproduktion absichtlich stimulieren und sich auf angenehme Gedanken einstimmen. Es entsteht Dopaminabhängigkeit und mit der Zeit Sucht. Der Patient benötigt immer mehr Dopamin und ruft ständig angenehme Assoziationen in seinem Gehirn hervor. Überstimulierte Gehirnzellen werden erschöpft – eine langfristige Dopaminabhängigkeit kann die Gehirngesundheit ernsthaft schädigen. Diese Theorie erklärt nicht viele Fälle des Zwangssyndroms.
- Erbliche Veranlagung – Eine Mutation des hSERT-Gens (Serotonintransporter) erhöht die Wahrscheinlichkeit eines genetisch bedingten Faktors für Angststörungen. Diese Theorie wird derzeit aktiv untersucht. Neben dem Vorhandensein dieses Gens wurde festgestellt, dass die Gesellschaft, in der der Träger des mutierten Gens lebt, von großer Bedeutung ist.
- Infektionskrankheiten, insbesondere Streptokokkeninfektionen, können eine Autoimmunreaktion der eigenen Antikörper auslösen, die versehentlich auf die Zerstörung des Gewebes der basalen Kerne des Gehirns abzielt. Eine andere, auf Forschung basierende Meinung besagt, dass das Zwangssyndrom nicht durch Streptokokken, sondern durch Antibiotika zur Behandlung der Infektion verursacht wird.
Viele Forscher haben schon lange festgestellt, dass die Erschöpfung des Körpers nach Infektionen, bei Frauen nach der Geburt und während der Stillzeit zu einer Verschlimmerung von Zwangsneurosen führt.
Symptome zwanghaftes Verhalten
Obsessionen treten bei einer Reihe psychogener, neurotischer oder psychischer Erkrankungen auf. Sie manifestieren sich im unwillkürlichen Auftreten zwanghafter Gedanken, Erinnerungen, Ideen und Vorstellungen, die der Patient als unangenehm, ihm absolut fremd und fremd empfindet und von denen er sich nicht befreien kann.
Psychische Symptome von Obsessionen – der Patient „verdaut“ ständig obsessive Gedanken, führt Dialoge mit sich selbst, grübelt über etwas nach. Er wird von Zweifeln und Erinnerungen gequält, die oft mit unvollendeten Prozessen verbunden sind; er möchte eine Handlung oder Tat ausführen, die nicht seinen Vorstellungen von der Norm der sozialen Moral und des Verhaltens entspricht. Solche Wünsche (Impulse) irritieren die Patienten, verursachen seelische Qualen und die Angst, dass sie dem Impuls dennoch nachgeben könnten, was jedoch nie geschieht.
Patienten werden von Gedanken an Angehörige oder Bekannte gequält, verbunden mit unbegründeter Aggression ihnen gegenüber, die dem Patienten Angst macht. Obsessive Erinnerungen sind auch schmerzhaft, negativer Natur, solche Erinnerungen werden von schmerzhaften Gefühlen über etwas Beschämendes begleitet.
Zwangsgedanken in Reinform sind vom Patienten subjektiv erlebte Denkstörungen und begleitende und als Abwehrreaktion auf Zwangsgedanken (Zwänge) hervorgerufene Bewegungsstörungen gehören zum Symptomkomplex der Zwangsstörung.
Phobien (Ängste) sind ebenfalls kein zwingender Bestandteil von Obsessionen, dennoch leiden Patienten häufig unter Phobien. Meistens haben sie Angst vor Schmutz, Keimen und Infektionen. Manche haben Angst, nach draußen zu gehen, sich in eine Menschenmenge zu stürzen oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Dies äußert sich in endlosem Händewaschen, Reinigen und Schrubben von Räumen, Möbeln, Geschirr und erfundenen Ritualen vor Handlungen, die Ablehnung und Angst auslösen. Um Phobien zu überwinden, entwickeln Menschen ein ganzes System ritueller Handlungen (Zwänge), die, wie es ihnen scheint, den erfolgreichen Abschluss einer unerwünschten Handlung sicherstellen können, wenn diese überhaupt nicht vermieden werden kann.
Panikattacken können auftreten, wenn der Patient eine angstauslösende Handlung ausführen muss. Neben psychischen Symptomen gehen solche Attacken oft mit einer Reihe vegetativer Symptome einher. Der Patient wird blass oder rot, schwitzt, fühlt sich schwindelig und kurzatmig, der Herzschlag beschleunigt oder verlangsamt sich und es besteht ein dringender Drang, die Toilette aufzusuchen.
Manchmal erleben Patienten Halluzinationen, aber das ist bei dieser Störung äußerst selten. Sie treten bei schweren Phobien auf, die nicht mehr in das moderne Verständnis von Obsessionen passen.
Obsessionen können verschiedene Wahrnehmungsstörungen verursachen. Eine der häufigsten Erscheinungsformen ist das sogenannte „Spiegelsymptom“, das der Depersonalisierung innewohnt. Patienten haben das Gefühl, verrückt zu werden, weil sie ihre Zwangsgedanken nicht loswerden können, und haben Angst, ihr Spiegelbild anzusehen, um keinen Funken Wahnsinn in ihren eigenen Augen zu sehen. Aus demselben Grund verbergen Menschen mit Obsessionen ihre Augen vor ihrem Gegenüber, damit dieser dort keine Anzeichen von Wahnsinn sieht.
Obsessionen unterscheiden sich vom gesunden Denken dadurch, dass sie nicht Ausdruck des Willens des Patienten sind und ihn nicht nur nicht als Person charakterisieren, sondern auch seinen persönlichen Eigenschaften entgegenstehen. Bei klarem Bewusstsein kann der Patient die ihn bedrängenden Gedanken nicht bewältigen, nimmt aber ihren negativen Kontext richtig wahr und versucht, ihnen zu widerstehen. Das gesunde Denken des Patienten versucht, Zwangsgedanken abzulehnen, sie werden als Pathologie wahrgenommen.
Obsessionen stehen in direktem Zusammenhang mit dem emotionalen Zustand des Betroffenen. Sie werden in Momenten deprimierten, ängstlichen Bewusstseins und der Sorge vor bevorstehenden Ereignissen aktiviert. Stressfaktoren können das Auftreten von Obsessionen fördern.
Wenn die Zwangsstörung nicht mit fortschreitenden psychischen Erkrankungen einhergeht, beeinträchtigt ihr Vorhandensein weder die intellektuellen Fähigkeiten des Patienten noch beeinflusst es die Entwicklung des Denkens.
Während der Abwesenheit von Zwangsgedanken erinnert sich der Patient an sie, erkennt ihre Anomalie und bleibt ihnen gegenüber kritisch. In Zeiten, in denen Zwangsgedanken und Phobien überhandnehmen, kann die Kritikfähigkeit stark abnehmen und sogar ganz verschwinden.
Das Subjekt kann sich nicht von Zwangsgedanken ablenken, sie durch Willensanstrengung beseitigen, aber es widersteht ihnen. Es gibt zwei Arten von Widerstand – aktiv und passiv. Aktiver Widerstand ist seltener und gilt als gefährlicher für den Patienten, da er mit der bewussten Anstrengung des Subjekts verbunden ist, eine psychotraumatische Situation zu schaffen und sich selbst zu beweisen, dass er diese überwinden kann. Der Patient provoziert sich ständig selbst, zum Beispiel mit dem obsessiven Wunsch, sich aus großer Höhe zu stürzen. Er kann regelmäßig auf hohe Gegenstände (eine Brücke, das Dach eines Gebäudes) klettern und dort lange Zeit verweilen und gegen sein Verlangen ankämpfen. Dies führt zu unerwünschten Reaktionen und erschöpft das Nervensystem stark.
Passiver Widerstand ist sanfter und hängt damit zusammen, dass der Patient versucht, nicht in Situationen zu geraten, die zwanghafte Vorstellungen hervorrufen. Auch Zwänge gehören zum passiven Widerstand.
Besessenheit während der Schwangerschaft
Es ist seit langem bekannt, dass in Zeiten erhöhter körperlicher Belastung, verminderter Immunität und Erschöpfung die Wahrscheinlichkeit der Manifestation von Obsessionen steigt oder deren Verschlimmerung häufiger auftritt. Wenn eine Frau darüber hinaus prädisponierende Persönlichkeitsmerkmale aufweist – Angst, Misstrauen – ist das Auftreten von Obsessionen durchaus verständlich. Die Schwangerschaft begünstigt auch die Manifestation von Neurosen und schwerwiegenderen psychischen Erkrankungen, die sich zuvor in keiner Weise manifestiert haben.
Die zwanghaften Gedanken, die eine schwangere Frau beunruhigen, betreffen am häufigsten die zukünftige Mutterschaft – ihre Gesundheit und die Gesundheit ihres Kindes, ihr finanzielles Wohlergehen, Angst vor der Geburt, ihren Komplikationen und Schmerzen.
Auf diesem Boden gedeihen klassische abstrakte Obsessionen – eine krankhafte Liebe zur Sauberkeit, Angst vor Infektionen in einer so kritischen Zeit, zwanghafte Rituale. Zwangsgedanken können alle Aspekte betreffen, aggressiver, sexueller oder religiöser Natur sein.
Die werdende Mutter meidet möglicherweise überfüllte Orte, Fremde und manchmal sogar Bekannte. Die Symptome von Obsessionen sind ungefähr gleich und hängen nicht von einer Schwangerschaft ab. Eine medikamentöse Therapie ist für eine werdende Mutter unerwünscht, psychotherapeutische Hilfe ist jedoch sehr angebracht, zumal sie in Fällen, die nicht durch psychische Erkrankungen verschlimmert werden, oft ausreichend ist.
Bühnen
In der Dynamik von Zwangsgedanken werden folgende Stadien unterschieden. Die ersten Anzeichen einer Zwangsstörung treten nur unter dem Einfluss von Stressfaktoren auf, wenn eine objektive Situation den Patienten wirklich beunruhigt. Dies ist die Anfangsphase des Prozesses. Da sie mit echter Angst verbunden ist, achtet der Patient selten auf Zwangsgedanken. Die zweite Phase beginnt, wenn ein Zwangsanfall mit dem bloßen Gedanken beginnt, dass sich der Patient hypothetisch in einer Angstsituation befinden könnte. In der dritten Phase genügt es dem Patienten, in einem Gespräch nur ein Wort zu hören, das mit seinen Ängsten verbunden ist, zum Beispiel „Virus“, „schmutzig“, „Krebs“ usw. Dieses sozusagen „pathogene“ Wort löst den Prozess der Zwangsstörung aus.
Formen
Viele Autoren haben mehrfach versucht, Obsessionen zu klassifizieren. Es besteht die Meinung, dass eine solche Klassifizierung keinen Sinn ergibt, da ein und derselbe Patient neben Phobien und Zwängen meist auch verschiedene Arten von Obsessionen gleichzeitig hat. Dennoch unterscheiden Spezialisten bestimmte Arten von Obsessionen.
Aus der Sicht der Physiologie psychiatrischer Symptome gehören Zwangsstörungen zu den Störungen der zentralen geistigen Aktivität und innerhalb dieser Störungen zu den assoziativen Störungen, d. h. zu Denkstörungen.
Alle Autoren klassifizieren das Zwangsgedankensyndrom als produktiv, einige psychiatrische Schulen betrachten es als die mildeste von ihnen. Nach der Klassifikation von AV Snezhnevsky werden neun produktive Schadenskreise unterschieden – von der emotional-hyperästhetischen Störung bis zur psychoorganischen (der schwersten Form). Obsessionen gehören zum dritten Schadenskreis – sie liegen zwischen affektiven und paranoiden Störungen.
Inländische Psychiater verwenden die Klassifikation des deutschen Psychiaters und Psychologen KT Jaspers, nach der zwei Haupttypen von Obsessionen unterschieden werden: abstrakte und figurative.
Abstrakte Obsessionen haben eine mildere klinische Form, werden nicht von Affekten begleitet, haben einen objektiven Hintergrund und ihre Manifestationen ähneln einer Manie. Dazu gehören:
- fruchtloses Philosophieren (Version des Autors), d. h. nutzloses „mentales Kaugummi“, das nie in die Tat umgesetzt wird und keinen praktischen Wert hat;
- Arrhythmomanie – der Patient zählt ständig die Schritte auf Treppen, Laternen, Fenstern, Pflastersteinen, Stufen, Häusern, Bäumen; erinnert sich an Geburtsdaten, Telefonnummern; führt Rechenoperationen im Kopf durch; in schweren Fällen – widmet er seine ganze Zeit Aktivitäten mit digitalem Material, das nur für ihn verständlich ist;
- einige Fälle von obsessiven Erinnerungen – normalerweise handelt es sich dabei um separate reale Ereignisse aus dem Leben des Patienten, aber er drängt jedem seine Erinnerungen auf (manchmal mehrmals) und erwartet vom Zuhörer, dass er von der Bedeutung der vergangenen Situation durchdrungen ist;
- Der Patient zerlegt Sätze in Wörter, Wörter in Silben und einzelne Buchstaben laut und manchmal wiederholt (eine ziemlich häufige Form sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen).
Eine schwerere Form des Krankheitsverlaufs ist durch figurative Obsessionen gekennzeichnet. Sie treten nur vor dem Hintergrund ständiger Angst und Sorge auf, sind eng mit negativen Stimmungsschwankungen verbunden und werden durch eine objektive Wahrnehmung bestimmter Ereignisse oder weit hergeholte, nicht existierende Gründe verursacht. Sie wirken sich negativ auf die Psyche des Patienten aus. Dieser Typ umfasst:
- zwanghafte Zweifel – der Patient ist sich nie sicher, ob er richtig handelt oder handeln will, er prüft und prüft erneut, wägt alle Optionen ab, beschreibt seine Erinnerungen oder Absichten detailliert, quält sich geistig und meistens werden die gewöhnlichsten und gewohnheitsmäßigsten Alltagshandlungen sowie standardmäßigen und eingeübten beruflichen Funktionen überprüft;
- Zwangsstörungen – der Patient wird von dem unwiderstehlichen Wunsch verzehrt, öffentlich eine Tat zu begehen, die nicht den Standards der öffentlichen Moral entspricht. Er stellt sich wiederholt vor, wie dies alles geschehen wird. Patienten mit Zwangsstörungen wagen es jedoch nie, eine solche Tat zu begehen.
- bildliche Zwangserinnerungen (psychopathologische Erfahrungen) unterscheiden sich von abstrakten Erinnerungen dadurch, dass der Patient vergangene Ereignisse lebhaft wiedererlebt;
- Ideen, die den Patienten ergreifen - Bilder ergreifen das Bewusstsein des Patienten so sehr, dass sein Denken vollständig in eine fiktive Realität übergeht. In diesem Fall wird das Maß an Kritik erheblich reduziert, Zwangshandlungen, Halluzinationen und Illusionen sind möglich.
- gegensätzliche Ideen und Gedanken – der Patient wird von Wünschen und Gedanken überwältigt, die seiner Weltanschauung und seinen moralischen und ethischen Grundsätzen widersprechen (z. B. blasphemische Gedanken bei einer tief religiösen Person, Ablehnung einer maßgeblichen Meinung, die der Patient außerhalb der Besessenheit teilt, der ethischen Standards, denen er folgt).
Obsessionen werden nach dem Entwicklungsmechanismus in elementare Obsessionen eingeteilt, deren Ursache für den Patienten offensichtlich ist, da sie unmittelbar durch starken Stress, beispielsweise bei einem Verkehrsunfall, entstanden sind, und kryptogene Obsessionen, deren Pathogenese nicht offensichtlich ist und vom Patienten nicht berücksichtigt wird, dennoch können im Rahmen einer Psychotherapie Ursache-Wirkungs-Beziehungen nach dem Kausalschema hergestellt werden.
Es gibt auch Erregungszwänge – Vorstellungen, Wünsche, Ängste – sowie Hemmungszwänge, bei denen der Patient unter bestimmten Umständen bestimmte Handlungen nicht ausführen kann.
Emotionale Obsessionen
Obsessive Ideen und Assoziationen, unwiderstehliche Wünsche, die immer wieder entgegen der Vernunft des Subjekts auftreten, für ihn oft unannehmbar sind, einen Zwangscharakter haben und in jedem Fall negative Emotionen hervorrufen.
Der emotionale Hintergrund leidet besonders bei figurativen Obsessionen; in solchen Fällen geht selbst eine moderate Obsession mit einem subdepressiven Zustand einher, der durch Symptome depressiver Stimmung, Minderwertigkeitsgefühle und mangelndes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gekennzeichnet ist. Patienten entwickeln oft ein Syndrom chronischer Müdigkeit, nervöser Erschöpfung mit Symptomen, die einer Neurasthenie ähneln – der Patient ist aus irgendeinem Grund gereizt und gleichzeitig schwach und apathisch. In Momenten, in denen der Patient von Zwangsgedanken überwältigt wird, machen sich unruhige motorische Fähigkeiten und ein ängstlich-depressiver Affekt bemerkbar.
Psychiater weisen darauf hin, dass zwanghafte Gedanken den Patienten erst dann verlassen, wenn Stärke und Intensität der mit den Obsessionen verbundenen Emotionen nachlassen.
 [ 25 ]
[ 25 ]
Sexuelle Obsessionen
Zwangsgedanken im Bereich der sexuellen Beziehungen können die unterschiedlichsten Aspekte betreffen. Oft sind sie mit abnormalen Manifestationen sexueller Wünsche verbunden, die von der öffentlichen Moral verurteilt werden – Inzest, gleichgeschlechtliche Liebe, Zoophilie.
Manchmal kommt es vor, dass Menschen auf die Idee kommen, mit jemand anderem Sex zu haben – mit einer Verkäuferin, einem Polizisten oder dem Lehrer ihres Kindes. Bei bildlichen Obsessionen sieht der Patient den gesamten Vorgang in Farben und Bildern. Manchmal quält ihn die Angst, dass es bereits geschehen ist.
Bei Phobien entsteht oft das Gefühl, man müsse noch etwas unternehmen, um nicht den Verstand zu verlieren.
Sexuelle Obsessionen entstehen oft aus der Sorge, dass der gewünschte Kontakt nicht zustande kommt – das Objekt der Zuneigung kommt nicht, lehnt ab, bevorzugt ein anderes. Oder es kann ein obsessiver Gedanke über ein negatives Ergebnis des sexuellen Kontakts auftreten – ungewollte Schwangerschaft, Krankheit. Solche Gedanken manifestieren sich in ständigen Gesprächen über die Unwirksamkeit von Verhütungsmitteln, das Vorhandensein von Mikroben usw. und schaffen auch Bedingungen, um die Möglichkeit von Sex zu leugnen.
Aggressive Besessenheit
Diese Art der obsessiven Ideenorientierung verursacht bei Patienten die größte Angst und Furcht. Menschen, die solchen Obsessionen unterliegen, haben Angst, dass ihre schrecklichen Gedanken wahr werden und unschuldigen Menschen spürbaren Schaden zufügen. Diese Gedanken sind wirklich beängstigend: bis hin zu sexueller Gewalt und Mord, und sie treten mit beneidenswerter Häufigkeit auf. In diesen Fällen versuchen Patienten oft, sich mit rituellen Handlungen vor den Wünschen zu schützen, die sie erschrecken. Selbst passiver Widerstand gegen obsessive Wünsche erschöpft das Nervensystem, und wenn das Subjekt aktiven Widerstand leistet, steigt die nervöse Anspannung. Seine Gedanken erschrecken ihn, er fühlt sich dafür schuldig und versucht, seine rituellen Handlungen vor anderen zu verbergen, um nicht aufzufallen und kein unerwünschtes Interesse an sich selbst zu wecken.
Aggressive und sexuelle Obsessionen sind am schmerzhaftesten und wechseln sich oft ab – Zwangsgedanken können in Bezug auf ein Sexualobjekt aggressiver Natur sein.
Obsessionen bei Schizophrenie
Das Phänomen der Obsession tritt laut verschiedenen Quellen bei einer kleinen Anzahl von Schizophrenen zwischen 1 und 7 % auf, ist jedoch durch einen ungünstigen Verlauf gekennzeichnet, da Schizophrenie eine schwere fortschreitende psychische Erkrankung ist. Schizophrene widersetzen sich in den meisten Fällen nicht zwanghaften Zwängen, sondern versuchen im Gegenteil, "Befehlen von oben" strikt zu folgen. Obsessionen sind charakteristisch für den Beginn einer neuroseähnlichen Form der Krankheit (paranoider Subtyp).
Obsessionen bei Schizophrenen können mit anderen Symptomen und dem für Schizophrenie charakteristischen mentalen Automatismus koexistieren. Sie werden in der Regel immer von Zwängen und Phobien begleitet. Der Entwicklung einer Zwangsstörung bei Schizophrenen in der Prodromalphase gehen verschiedene Sinnesvorstellungen, die Faszination für pseudowissenschaftliche Forschung und ein depressiver Zustand mit überwiegender Apathie voraus.
Obsessionen bei Schizophrenie treten spontan auf, äußern sich meist in der Entstehung von Zweifeln und Ideen und werden recht schnell von zwanghaften Ritualen überwuchert, die für einen Außenstehenden sehr absurd und unverständlich sind. Obsessionen bei Schizophrenen neigen zur Verallgemeinerung.
Wenn sie sich als soziale Phobien manifestierten, versuchte der Patient, unbekannte Menschen zu meiden und nicht an überfüllten Orten aufzutreten. Phobien bei Schizophrenen sind sehr vielfältig, von Angst vor Spritzen, Glasscherben, Krankheiten bis hin zu emotional aufgeladenen Panikattacken, die während der Wartezeit auf den nächsten Anfall durch Angstzustände und vegetative Störungen kompliziert wurden, obwohl im Allgemeinen mit dem Fortschreiten der Krankheit die Emotionen allmählich verloren gehen.
Bei träger Schizophrenie kritisieren die Patienten lange Zeit Zwangsgedanken und Ängste und versuchen, mit den Anfällen fertig zu werden. Die Kritikschwelle sinkt jedoch allmählich und der Kampf hört auf.
Obsessionen bei Schizophrenen unterscheiden sich von denen bei Patienten mit neuroseähnlichen Störungen durch eine stärkere Besessenheitskraft, komplexere und absurdere Rituale, deren Durchführung lange Zeit gewidmet ist. Schizophrene führen zwanghafte Handlungen ohne Verlegenheit aus, manchmal versuchen sie, nahestehende Personen in die Aufführung einzubeziehen, im Gegensatz zu Neurotikern, die versuchen, ihre Rituale vor neugierigen Blicken zu verbergen.
Bei der Schizophrenie treten Zwangsvorstellungen zusammen mit anderen psychischen Störungen auf, während bei Neurotikern Zwangsvorstellungen in den meisten Fällen nur einen depressiven Zustand hervorrufen.
Charakteristisch für Schizophrene ist das Auftreten von Selbstmordgedanken und Selbstmordverhalten, während praktisch gesunde Menschen diese nicht aufweisen.
Menschen mit Schizophrenie kommen oft ohne Betreuung im Alltag nicht zurecht, meiden Fremde und können weder arbeiten noch studieren. Im Gegensatz zu Menschen mit Neurosen verlieren diese in der Regel ihre Arbeitsfähigkeit nicht und schaffen sich mitunter Lebens- und Arbeitsbedingungen, die eine soziale Anpassung fördern.
Religiöse Obsessionen
Ein sehr verbreiteter Thementyp ist die religiös motivierte Besessenheit; im weiteren Sinne kann diese Gruppe auch vielfältige Aberglauben umfassen, bei denen es darum geht, allerlei rituelle Handlungen durchzuführen, um Unheil abzuwehren – etwa auf Holz klopfen, über die linke Schulter spucken usw.
Zu den positiven und sogar beruhigenden Symptomen können rituelle Handlungen gehören, wie etwa das Berühren von Perlen, das Tragen und Küssen religiöser Accessoires, das Rezitieren von Gebetstexten und rituelle Reinigungen.
Negative Emotionen bei einem religiösen Patienten verursachen zwanghafte, blasphemische Gedanken und Wünsche, die manchmal eine sexuelle oder aggressive Färbung haben. Sie stürzen den Patienten in Entsetzen und erfordern viel Kraft, um diese Wünsche zu bekämpfen. Sie zwingen ihn, mit großem Eifer Gebete zu lesen, Fasten und andere religiöse Rituale einzuhalten, um Vergebung zu erlangen.
Komplikationen und Konsequenzen
Bei anhaltenden Zwangszuständen erfährt eine Person sekundäre Charakterveränderungen - Beeinflussbarkeit, Misstrauen, schmerzhafte Schüchternheit treten auf oder nehmen zu, eine Person verliert das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, das Vorhandensein von Phobien führt dazu, dass der Patient versucht, Situationen zu vermeiden, die ihn stören, beginnt seltener das Haus zu verlassen, sich mit Freunden zu treffen, zu Besuch zu gehen - gerät in soziale Isolation, kann seinen Job verlieren.
Obsessionen bei Schizophrenie sind in dieser Hinsicht besonders gefährlich, obwohl sie Symptome verschiedener Krankheiten und Störungen sein können. Die rechtzeitige Suche nach medizinischer Hilfe anstelle eines unabhängigen, anstrengenden Kampfes mit Obsessionen ist in jedem Fall relevant und hilft dem Patienten, psychische Stabilität zu erlangen.
Diagnose zwanghaftes Verhalten
Das Vorhandensein von Zwangsgedanken bei einem Patienten wird zunächst mit psychometrischen Methoden festgestellt. Der Arzt hört sich die Beschwerden des Patienten an und bietet ihm einen Obsessionstest an. Die am häufigsten verwendete Skala zur Bestimmung von Zwangszuständen ist die Yale-Brown-Skala, benannt nach den Universitäten, deren Spezialisten sie entwickelt haben. Sie besteht aus nur zehn Punkten, von denen fünf den Obsessionen und die anderen fünf den zwanghaften Ritualen gewidmet sind. Anhand der Punktzahl des Patienten lassen sich das Vorhandensein von Zwangsgedanken und Zwängen, die Fähigkeit, ihnen zu widerstehen, und die Schwere der Störung bestimmen. Der Patient kann mehrmals, beispielsweise während der Woche, getestet werden. Dies ermöglicht es, die Dynamik des klinischen Verlaufs der Störung zu beurteilen.
Zwangsstörungen sind ein Symptom vieler pathologischer Zustände, daher werden weitere Untersuchungen durchgeführt, um die Ursache ihres Auftretens zu ermitteln.
Die Forschung wird in Abhängigkeit von den vermuteten Ursachen durchgeführt und umfasst allgemeine klinische und spezifische Tests sowie instrumentelle Diagnostik des Gehirnzustands – Ultraschall, Elektroenzephalographie, Tomographie.
Differenzialdiagnose
Die Differentialdiagnostik unterscheidet zwischen Obsessionen und Zwängen. Theoretisch können Zwangsgedanken den Patienten belagern und zu keinen Handlungen führen, ebenso wie Zwangshandlungen (Zwänge) möglicherweise nicht mit Zwangsgedanken einhergehen. Obsessive Bewegungen, die nicht rituell sind, gelten als willentlich, sind aber für den Patienten so gewohnheitsmäßig, dass es für ihn sehr schwierig ist, sie loszuwerden. In der Praxis treten jedoch in der Regel beide Symptome bei demselben Patienten auf. Darüber hinaus werden Phobien unterschieden, die jedoch auch vor dem Hintergrund einer Obsession auftreten, insbesondere wenn diese aggressiver, sexueller oder offen gegensätzlicher Natur ist.
Obsessionen unterscheiden sich von Panikattacken, die auch eine Zwangsstörung begleiten können, ein Symptom einer Neurose oder Schizophrenie sein können. Episodische Anfälle unkontrollierbarer Angst sind jedoch kein zwingendes Symptom von Obsessionen.
Die Aufgabe der Differentialdiagnose besteht darin, Zwangsstörungen von Zwangsstörungen, Schizophrenie, Epilepsie, dissoziativen Störungen und anderen Krankheiten abzugrenzen, in deren Symptomenkomplex ein Zwangssyndrom beobachtet werden kann.
Wen kann ich kontaktieren?
Verhütung
Sie können dem Auftreten von Zwangsgedanken vorbeugen und die Remissionsphase verlängern, indem Sie sich gut ernähren, ausreichend ausruhen, sich nicht über Kleinigkeiten aufregen und eine positive Einstellung zur Welt entwickeln.
Das Zwangssyndrom entwickelt sich bei Menschen mit einem bestimmten Persönlichkeitstyp: misstrauisch, beeinflussbar, ängstlich und unruhig, die an ihren Fähigkeiten zweifeln. Dies sind die Charaktereigenschaften, die korrigiert werden müssen. Selbstständig – mit Autotrainingstechniken, Meditation, einer Änderung der Lebenseinstellung oder der Hilfe von Psychotherapeuten – durch die Teilnahme an Schulungen, Gruppen- und Einzelsitzungen.
Prognose
Kurzfristige Zwangsstörungen, die nicht länger als zwei Jahre andauerten, führten zu keinen Veränderungen im Charakter der Patienten. Daher können wir den Schluss ziehen, dass die Chancen auf eine verlustfreie Veränderung der Situation umso größer sind, je früher mit der Behandlung begonnen wird.
Langfristige Zwangsgedanken beeinflussen den Charakter und das Verhalten von Menschen und verstärken ängstliche und misstrauische Persönlichkeitsmerkmale. Patienten, die seit langem unter Zwangszuständen leiden, erhalten unterschiedliche Diagnosen. Beispielsweise haben Zwangsgedanken bei Schizophrenie eine ungünstige Prognose.
 [ 35 ]
[ 35 ]

