
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Autoimmunes lymphoproliferatives Syndrom
Facharzt des Artikels
Zuletzt überprüft: 04.07.2025
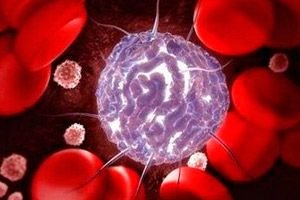
Das Autoimmune Lymphoproliferative Syndrom (ALPS) ist eine Erkrankung, die durch angeborene Defekte der Fas-vermittelten Apoptose verursacht wird. Es wurde 1995 beschrieben, seit den 1960er Jahren ist jedoch eine Krankheit mit ähnlichem Phänotyp als CanaLe-Smith-Syndrom bekannt.
Charakteristisch für die Erkrankung sind eine chronische, nicht maligne Lymphoproliferation und Hypergammaglobulinämie, die mit verschiedenen Autoimmunerkrankungen einhergehen können.
Pathogenese
Apoptose, der physiologische Zelltod, ist einer der wesentlichen Mechanismen zur Aufrechterhaltung der körpereigenen Homöostase. Apoptose entsteht durch die Aktivierung verschiedener Signalmechanismen. Die durch die Aktivierung von Fas-Rezeptoren (CD95) während ihrer Interaktion mit dem entsprechenden Liganden (Fas-Ligand, FasL) vermittelte Apoptose spielt eine besondere Rolle bei der Regulierung des hämatopoetischen Systems und des Immunsystems. Fas ist auf verschiedenen hämatopoetischen Zellen vorhanden; eine hohe Expression des Fas-Rezeptors ist charakteristisch für aktivierte Lymphozyten. FasL wird hauptsächlich von CD8+ T-Lymphozyten exprimiert.
Die Aktivierung des Fas-Rezeptors führt zu einer Reihe intrazellulärer Prozesse, die zur Desorganisation des Zellkerns, zur Denaturierung der DNA und zu Veränderungen der Zellmembran führen. Diese führen zu deren Zerfall in zahlreiche Fragmente, ohne dass lysosomale Enzyme in die extrazelluläre Umgebung freigesetzt werden und ohne dass eine Entzündung ausgelöst wird. Eine Reihe von Enzymen, sogenannte Caspasen, darunter Caspase 8 und Caspase 10, sind an der Übertragung des Apoptosesignals an den Zellkern beteiligt.
Die Fas-vermittelte Apoptose spielt eine wichtige Rolle bei der Eliminierung von Zellen mit somatischen Mutationen, autoreaktiven Lymphozyten und Lymphozyten, die ihre Rolle in der normalen Immunantwort erfüllt haben. Eine gestörte T-Lymphozyten-Apoptose führt zur Expansion aktivierter T-Zellen sowie sogenannter doppelt-negativer T-Lymphozyten, die den T-Zell-Rezeptor mit a/b-Ketten (TCRa/b) exprimieren, aber weder CD4- noch CD8-Moleküle besitzen. Ein fehlerhafter programmierter B-Zell-Tod in Kombination mit erhöhten Interleukin-10-(IL-10)-Spiegeln führt zu Hypergammaglobulinämie und einem erhöhten Überleben autoreaktiver B-Lymphozyten. Klinische Folgen sind eine übermäßige Ansammlung von Lymphozyten im Blut und in den lymphatischen Organen, ein erhöhtes Risiko für Autoimmunreaktionen und Tumorwachstum.
Bisher wurden mehrere molekulare Defekte identifiziert, die zum Versagen der Apoptose und zur Entwicklung von ALL führen. Dabei handelt es sich um Mutationen in den Genen Fas, FasL, Caspase 8 und Caspase 10.
Symptome autoimmunes lymphoproliferatives Syndrom.
ALPS ist durch eine große Variabilität im Spektrum der klinischen Manifestationen und des Schweregrads gekennzeichnet, wobei auch das Alter der klinischen Manifestation je nach Schwere der Symptome schwanken kann. Es sind Fälle bekannt, in denen Autoimmunmanifestationen erst im Erwachsenenalter auftraten, als ALPS diagnostiziert wurde. Manifestationen des lymphoproliferativen Syndroms treten von Geburt an in Form einer Vergrößerung aller Lymphknotengruppen (peripher, intrathorakal, intraabdominal), einer Vergrößerung der Milz und häufig der Leber auf. Die Größe der lymphatischen Organe kann sich im Laufe des Lebens verändern, manchmal wird ihre Vergrößerung bei interkurrenten Infektionen beobachtet. Die Lymphknoten haben eine normale Konsistenz, manchmal sind sie dicht und schmerzlos. Es sind Fälle schwerer Manifestationen eines hyperplastischen Syndroms bekannt, das ein Lymphom imitiert, mit einer Vergrößerung der peripheren Lymphknoten, die zu Deformationen des Halses, Hyperplasie der intrathorakalen Lymphknoten bis hin zur Entwicklung eines Kompressionssyndroms und respiratorischer Insuffizienz führt. Lymphatische Infiltrate in der Lunge wurden beschrieben. In vielen Fällen sind die Symptome des hyperplastischen Syndroms jedoch weniger dramatisch und bleiben von Ärzten und Eltern unbemerkt. Auch der Grad der Splenomegalie ist sehr unterschiedlich.
Die Schwere der Erkrankung wird hauptsächlich durch Autoimmunmanifestationen bestimmt, die in jedem Alter auftreten können. Am häufigsten treten verschiedene Immunhämopathien auf - Neutropenie, Thrombozytopenie, hämolytische Anämie, die in Form einer Zwei- und Dreilinienzytopenie kombiniert werden können. Eine einzelne Episode einer Immunzytopenie kann auftreten, sie ist jedoch häufig chronisch oder rezidivierend.
Andere, seltenere Autoimmunmanifestationen können Autoimmunhepatitis, Arthritis, Sialadenitis, entzündliche Darmerkrankungen, Erythema nodosum, Pannikulitis, Uveitis und das Guiltain-Barré-Syndrom sein. Darüber hinaus können verschiedene Hautausschläge, hauptsächlich Urtikaria, subfebrile oder fieberhafte Hautausschläge ohne Zusammenhang mit einem Infektionsprozess, beobachtet werden.
Patienten mit einem autoimmunen lymphoproliferativen Syndrom weisen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung eine erhöhte Inzidenz maligner Tumoren auf. Es wurden Fälle von Hämoblastosen, Lymphomen und soliden Tumoren (Leber- und Magenkarzinom) beschrieben.
 [ 8 ]
[ 8 ]
Formen
Im Jahr 1999 wurde eine Arbeitsklassifikation des Autoimmun-Lymphoproliferativen Syndroms vorgeschlagen, die auf der Art des Apoptosedefekts basiert:
- ALP5 0 – vollständiger Mangel an CD95, der aus einer homozygoten Nullmutation (homozygote nuLl-Mutation) im Fas/CD95-Gen resultiert;
- ALPS I – Defekt in der Signalübertragung durch den Fas-Rezeptor.
- In diesem Fall ist ALPS la eine Folge eines Defekts im Fas-Rezeptor (heterozygote Mutation im Fas-Gen);
- ALPS lb ist eine Folge eines Defekts im Fas-Liganden (FasL), der mit einer Mutation im entsprechenden Gen – FASLG/CD178 – verbunden ist;
- ALPS Ic ist das Ergebnis einer neu identifizierten homozygoten Mutation im FA5LG/CD178-Gen;
- ALPS II – ein Defekt in der intrazellulären Signalübertragung (Mutation im Caspase-10-Gen – ALPS IIa, im Caspase-8-Gen – ALPS IIb);
- ALPS III – molekularer Defekt nicht identifiziert.
Art der Vererbung
ALPS Typ 0, ein vollständiger Mangel an CD95, wurde bisher nur bei wenigen Patienten beschrieben. Da heterozygote Familienmitglieder den ALPS-Phänotyp nicht aufweisen, wurde ein autosomal-rezessiver Vererbungsverlauf vermutet. Unveröffentlichte Daten aus einer Familie mit ALPS Typ 0 decken sich jedoch nicht vollständig mit dieser Annahme. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass viele, wenn nicht alle Mutationen dominant sind und homozygot zu einem schwereren Krankheitsphänotyp führen.
Bei ALPS Typ I ist das Vererbungsmuster autosomal-dominant, mit unvollständiger Penetranz und variabler Expressivität. Insbesondere bei ALPS1a wurden Fälle von Homozygotie oder kombinierter Heterozygotie beschrieben, bei denen verschiedene Mutationen des Fas-Gens in beiden Allelen festgestellt werden. Diese Fälle waren durch einen schweren Verlauf mit pränataler oder neonataler Manifestation (fetaler Hydrops, Hepatosplenomegalie, Anämie, Thrombozytopenie) gekennzeichnet. Darüber hinaus wurde eine Korrelation zwischen der Schwere der klinischen Symptome und der Art der Mutation im Fas-Gen gefunden; ein schwererer Verlauf ist charakteristisch für eine Mutation im intrazellulären Bereich. Insgesamt wurden weltweit mehr als 70 Patienten mit ALPS la beschrieben. Die FasL-Mutation wurde erstmals bei einem Patienten mit klinischen Manifestationen von systemischem Lupus erythematodes und chronischer Lymphoproliferation beschrieben. Es wurde als ALPS lb kategorisiert, obwohl der Phänotyp die Kriterien für das klassische autoimmune lymphoproliferative Syndrom nicht vollständig erfüllte (doppelt negative T-Zellen und Splenomegalie fehlten). Die erste homozygote Mutation A247E im FasL-Gen (extrazelluläre Domäne) wurde erst kürzlich, im Jahr 2006, von Del-Rey M et al. bei einem Patienten mit nichtletalem ALPS beschrieben, was auf eine wichtige Rolle der terminalen Domäne von FasL C0OH in der Fas/FasL-Interaktion hinweist. Die Autoren schlagen vor, die ALPS-Ic-Untergruppe in die aktuelle Klassifikation des autoimmunen lymphoproliferativen Syndroms aufzunehmen.
ALPS Typ II wird autosomal-rezessiv vererbt, und viele Patienten mit dieser Art von Erkrankung weisen ein typisches klinisches und immunologisches ALPS auf, einschließlich einer beeinträchtigten Fas-vermittelten Apoptose, an deren Umsetzung sowohl Caspase 8 (beteiligt an den frühen Stadien der interzellulären Signalübertragung auf der Ebene der TCR- und BCR-Interaktionen) als auch Caspase 10 (beteiligt an der apoptotischen Kaskade auf der Ebene aller bekannten Rezeptoren, die die Apoptose von Lymphozyten induzieren) beteiligt sind.
Mehr als 30 Patienten wiesen ein mittelschweres klinisches Bild von ALPS auf, darunter Hypergammaglobulinämie und erhöhte Werte doppelt negativer T-Zellen im Blut, und aktivierte Lymphozyten von Patienten mit ALPS Typ III (so der Name dieses Syndroms) zeigten in vitro eine normale Aktivierung des Fas-vermittelten Signalwegs, und es wurden keine molekularen Defekte gefunden. Es ist möglich, dass die Krankheit durch Störungen anderer apoptotischer Signalwege verursacht wird, wie sie beispielsweise durch Trail-R, DR3 oder DR6 vermittelt werden. Interessant ist die Beobachtung der N252S-Mutation im Perforin-Gen (PRF1) durch R. Qementi bei einem Patienten mit ALPS Typ III, der eine signifikant verringerte NK-Aktivität aufwies. Der Autor weist darauf hin, dass der signifikante Unterschied zwischen der Häufigkeit des N252S-Nachweises bei Patienten mit ALPS (2 von 25) und der Häufigkeit seines Nachweises in der Kontrollgruppe (1 von 330) auf einen Zusammenhang mit der Entwicklung von ALPS in der italienischen Bevölkerung hindeutet. Andererseits stellt F. Rieux-Laucat fest, dass er diese Variante der PRF1-Mutation bei 18 % der gesunden Personen und bei 10 % der Patienten mit ALPS (unveröffentlichte Daten) entdeckt hat. Darüber hinaus fand er zusammen mit dem N252S-Polymorphismus eine Mutation des Fas-Gens bei einem Patienten mit ALPS und seinem gesunden Vater, was laut F. Rieux-Laucat auf die Nichtpathogenität der heterozygoten Mutation N252S im Perforin-Gen hinweist, die etwas zuvor von R. Qementi bei einem Patienten mit ALPS (Fas-Mutation) und großzelligem B-Lymphom beschrieben wurde. Daher bleibt die Frage nach den Ursachen von ALPS Typ III bis heute offen.
Diagnose autoimmunes lymphoproliferatives Syndrom.
Eines der Anzeichen eines lymphoproliferativen Syndroms können absolute Lymphozytos im peripheren Blut und Knochenmark sein. Der Lymphozytengehalt steigt aufgrund von B- und T-Lymphozyten, in einigen Fällen - nur aufgrund einer der Subpopulationen,
Charakteristisch ist ein erhöhter Gehalt an doppelt negativen Lymphozyten mit dem Phänotyp CD3+CD4-CD8-TCRa/b im peripheren Blut. Dieselben Zellen finden sich im Knochenmark, in den Lymphknoten und in lymphozytären Infiltraten der Organe.
Eine verminderte Expression von CD95 (Fas-Rezeptor) auf Lymphozyten ist kein diagnostisches Kriterium für das autoimmune lymphoproliferative Syndrom, da sein Spiegel bei einigen Fas-Defekten mit Mutation im intrazellulären Bereich sowie bei ALPS Typ II und III im Normbereich bleiben kann.
Ein typisches Symptom des autoimmunen lymphoproliferativen Syndroms ist eine Hyperimmunglobulinämie, die auf einen Anstieg der Immunglobulinspiegel aller und einzelner Klassen zurückzuführen ist. Der Grad der Erhöhung kann variieren.
Es gibt vereinzelte Fälle eines autoimmunen lymphoproliferativen Syndroms mit Hypoimmunglobulinämie, deren Ursache unklar ist. Eine Immunschwäche ist eher bei Patienten mit ALPS IIb typisch, wurde aber auch bei ALPS Typ 1a beschrieben.
Patienten können verschiedene Autoantikörper haben: Antikörper gegen Blutzellen, ANF, Antikörper gegen native DNA, Anti-RNP, Anti-SM, Anti-SSB, RF, Antikörper gegen den Gerinnungsfaktor VIII.
Erhöhte Serumtriglyceridwerte wurden bei Patienten mit autoimmunem lymphoproliferativem Syndrom berichtet; Hypertriglyceridämie wird als Folge einer erhöhten Produktion von Zytokinen, insbesondere des Tumornekrosefaktors (TNF), die den Fettstoffwechsel beeinflussen, vermutet. Bei den meisten Patienten mit autoimmunem lymphoproliferativem Syndrom finden sich signifikant erhöhte TNF-Spiegel. Bei einigen Patienten korrelieren die Hypertriglyceridwerte mit dem Krankheitsverlauf und steigen während Exazerbationen an.
Die Notwendigkeit einer Differentialdiagnostik bei malignen Lymphomen bestimmt die Indikationen für eine offene Biopsie des Lymphknotens. Die morphologische und immunhistochemische Untersuchung des Lymphknotens zeigt eine Hyperplasie der parakortikalen Zonen und in einigen Fällen Follikel, Infiltration durch T- und B-Lymphozyten, Immunoblasten und Plasmazellen. In einigen Fällen werden Histiozyten gefunden. Die Struktur des Lymphknotens bleibt in der Regel erhalten, in einigen Fällen kann sie aufgrund einer ausgeprägten gemischten Zellinfiltration etwas ausgelöscht sein.
Bei Patienten, die sich aufgrund chronischer Immunhämatopathien einer Splenektomie unterzogen haben, wird eine gemischte lymphatische Infiltration festgestellt, darunter auch Zellen der doppelt negativen Population.
Eine spezifische Methode zur Diagnose des autoimmunen lymphoproliferativen Syndroms ist die Untersuchung der Apoptose peripherer mononukleärer Zellen (PMN) des Patienten in vitro, induziert durch monoklonale Antikörper gegen den Fas-Rezeptor. Bei ALPS kommt es zu keinem Anstieg der Anzahl apoptotischer Zellen, wenn PMN mit Anti-FasR-Antikörpern inkubiert werden.
Molekulardiagnostische Methoden zielen auf die Identifizierung von Mutationen in den Genen Fas, Caspase 8 und Caspase 10 ab. Bei normalen Ergebnissen der PMN-Apoptose und dem Vorliegen eines phänotypischen Bildes von ALPS ist eine Untersuchung des FasL-Gens angezeigt.
Was muss untersucht werden?
Differenzialdiagnose
Die Differentialdiagnose des autoimmunen lymphoproliferativen Syndroms wird bei folgenden Erkrankungen durchgeführt:
- Infektionskrankheiten (Virusinfektionen, Tuberkulose, Leishmaniose usw.)
- Bösartige Lymphome.
- Hämophagozytische Lymphohistiozytose.
- Speicherkrankheiten (Morbus Gaucher).
- Sarkoidose.
- Lymphadenopathie bei systemischen Bindegewebsinvasionen.
- Andere Immundefizienzzustände (variabler Immundefekt, Wiskott-Aldrich-Syndrom).
Behandlung autoimmunes lymphoproliferatives Syndrom.
Beim isolierten lymphoproliferativen Syndrom ist eine Therapie in der Regel nicht erforderlich, außer bei schwerer Hyperplasie mit mediastinalem Kompressionssyndrom und der Entwicklung lymphatischer Infiltrate in Organen. In diesem Fall wird eine immunsuppressive Therapie eingesetzt (Glukokortikoide, Cyclosporin A, Cyclophosphamid).
Die Behandlung von Autoimmunkomplikationen erfolgt nach den allgemeinen Therapieprinzipien der entsprechenden Erkrankungen – bei Hämopathien wird (Methyl)prednisolon in einer Dosis von 1–2 mg/kg oder im Pulstherapiemodus mit anschließender Umstellung auf Erhaltungsdosen verordnet; bei unzureichender oder instabiler Wirkung wird eine Kombination von Kortikosteroiden mit anderen Immunsuppressiva verwendet, zum Beispiel: Mycophenolatmofetil, Cyclosporin A, Azathioprin, monoklonale Antikörper gegen Anti-CD20 (Rituximab). Eine Therapie mit hohen Dosen intravenöser Immunglobuline (IVIG) führt in der Regel zu einer unbefriedigenden oder instabilen Wirkung. Aufgrund der Tendenz zum chronischen oder rezidivierenden Verlauf ist eine Langzeittherapie mit individuell ausgewählten Erhaltungsdosen erforderlich. Bei unzureichender Wirkung der medikamentösen Therapie, wenn hohe Medikamentendosen erforderlich sind, kann eine Splenektomie wirksam sein.
Bei schwerem Verlauf oder vorhergesagtem Fortschreiten der Erkrankung ist eine hämatopoetische Stammzelltransplantation angezeigt, allerdings sind die Erfahrungen mit der Transplantation beim autoimmunen lymphoproliferativen Syndrom weltweit begrenzt.
Prognose
Die Prognose hängt vom Schweregrad der Erkrankung ab, der meist durch die Schwere der Autoimmunmanifestationen bestimmt wird. Bei schweren, therapieresistenten Hämopathien ist ein ungünstiger Verlauf wahrscheinlich.
Mit zunehmendem Alter kann der Schweregrad des lymphoproliferativen Syndroms abnehmen, dies schließt jedoch das Risiko schwerer Autoimmunkomplikationen nicht aus. In jedem Fall hilft eine adäquate Prognose, für jeden Patienten einen optimalen Therapieansatz zu entwickeln.
 [ 13 ]
[ 13 ]

