
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Selen unter der Lupe: Von einem „engen Sicherheitsfenster“ zu neuen therapeutischen Ideen
Zuletzt überprüft: 18.08.2025
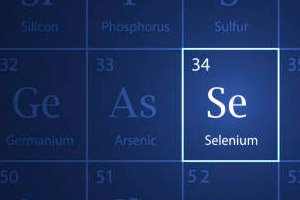 ">
">Selen ist ein Spurenelement mit einer komplizierten Biografie: Seit seiner Entdeckung im Jahr 1817 galt es als giftig, bis man 1957 herausfand, dass es Vitamin-E-Mangel-Ratten vor Lebernekrose schützt und für den Menschen lebenswichtig ist. Heute sind etwa 25 Selenoproteingene und Dutzende von Prozessen bekannt, an denen sie beteiligt sind – vom antioxidativen Schutz und der Transkriptionsregulation bis hin zu Immun- und Fortpflanzungsfunktionen. Doch Selen hat auch eine „dunkle Seite“: einen engen sicheren Verzehrbereich und verschiedene Formen mit sehr unterschiedlicher Bioverfügbarkeit. All dies bildete die Grundlage einer Sonderausgabe von Nutrients, für die die Herausgeber neue Daten sammelten – von Zell- und Tiermodellen bis hin zu Studien am Menschen.
Hintergrund
Selen ist ein paradoxer Mikronährstoff: Wichtige Enzyme des antioxidativen Schutzes und des Schilddrüsenstoffwechsels (Selenoproteine der GPx-, TrxR-, Deiodinase-Familie) sowie das Immunsystem und die Fortpflanzungsfunktionen können ohne Selen nicht funktionieren. Seine „nützliche Dosis“ ist jedoch gering und die biologische Wirkung hängt stark von der Form (Selenit, Selenomethionin/Hefe, neue Nanoformen) und der Grundnahrung ab. Weltweit ist der Status von Selen unterschiedlich verteilt: In Regionen mit armen Böden traten historisch Mangelerscheinungen (Kardiomyopathie, Arthropathien) auf, während in „reichen“ Regionen das Risiko eines chronischen Überschusses (Selenose), Haarausfall und Dermatopathien besteht. Für Klinik und öffentliche Gesundheit entsteht dadurch ein „U-förmiges“ Problem: Sowohl Mangel als auch Überschuss sind gleichermaßen gefährlich.
Das Bild wird durch Methodik und Beweise kompliziert.
- Statusmessungen: Gesamtserum-Se, Selenoprotein P, GPx-Aktivität – Marker unterschiedlicher „Tiefe“, nicht immer austauschbar.
- Heterogenität der Interventionen: organische und anorganische Formen, Dosierung „nach Augenmaß“, unterschiedliche Lebensmittelmatrizes → unterschiedliche Bioverfügbarkeit und Verteilung im Gewebe.
- Endpunkte: von molekular (Redoxsignale, Ferroptose) bis klinisch (kardiovaskuläre, Leber-, onkologische Ergebnisse); randomisierte Studien mit harten Endpunkten sind nicht immer verfügbar.
- Nährstoffkombinationen: Selen wird seit langem „in Kombination“ untersucht (z. B. mit Vitamin E, Coenzym Q₁₀), aber die Regeln, „wer mit wem und wann“, werden noch immer festgelegt.
- Persönliche Faktoren: Genetik des Se-Stoffwechsels, Mikrobiota, Protein-Aminosäure-Hintergrund der Ernährung, Alter und Begleiterkrankungen verändern die Reaktion auf die gleichen Dosen.
Vor diesem Hintergrund entstand die Themenausgabe „Nährstoffe“: Sie systematisiert, wo Selen tatsächlich Vorteile bietet (und in welcher Form), wo die Risiken überwiegen, wie Selen mit anderen Mikro- und Makronährstoffen kombiniert werden kann und welche Modelle/Biomarker in zukünftigen Studien verwendet werden sollten. Ziel ist es, von der universellen Empfehlung „Nehmen Sie Selen“ zu einer präzisen Ernährung zu gelangen: Beurteilung des Ausgangszustands, ausgewogene Wahl von Form und Dosis, klare Indikationen und Sicherheitsüberwachung.
Was ist wichtig über Selen
- Biologie: Wichtige Effekte werden durch Selenoproteine (z. B. die Glutathionperoxidase-Familie) vermittelt, die die Redoxhomöostase, Apoptose, ZNS-Entwicklung und Stressresistenz unterstützen.
- Die Dosis entscheidet alles: Ein Mangel ist mit Immunstörungen und bestimmten Krankheiten verbunden, ein Überschuss mit Dermatitis, Haarausfall und einem möglichen Anstieg des Risikos einer Reihe von Stoffwechsel-/neurologischen Problemen. Der „goldene Mittelweg“ hängt von der Form (organisches/anorganisches Selen) und dem Aminosäurehintergrund in der Ernährung ab.
- Die Form ist wichtig: Selenit, Selenomethionin/Hefe, Nanopartikel – diese haben unterschiedliche Pharmakokinetik und Gewebewirkungen; „ein Selen“ ≠ „alle gleich“.
Das Problem erwies sich als „Mosaik“: Die Autoren suchen nicht nach einer Wunderpille, sondern zeigen, wo genau Mikroelemente (einschließlich Selen) den Krankheitsverlauf verändern können – und wo es für eindeutige Schlussfolgerungen noch zu früh ist. Nachfolgend die wichtigsten Punkte.
Was die Sonderausgabe zeigte: Wichtige Erkenntnisse und Trends
- Wer erhält sein Selen und woher (USA, NHANES): Querschnittsdaten deuten darauf hin, dass die Gesamtmenge an Selen in der Nahrung der wichtigste Prädiktor für den Selenspiegel im Blut ist (unter Berücksichtigung von Geschlecht, Rasse, Bildung, Einkommen, BMI, Rauchen/Alkohol). Eine separate Analyse bringt Selen und Mangan mit besseren Erythrozytenwerten in Verbindung, Chrom mit schlechteren (Blutspiegel-Assoziationen).
- Muskeln und Se-Formen (Jugendmodell): Selenit- und Selen-Nanopartikel wirken unterschiedlich: Se-NPs verschlechterten den Muskelaufbau, den Proteinaufbau und störten die Insulinsignalisierung, während Selenit im Gegenteil den Katabolismus „löschte“. Fazit: Das therapeutische Potenzial hängt von der Form ab.
- Leber und Selen: Die gleichzeitige Gabe von Coenzym Q und Selen im MASH-Modell reduzierte oxidativen Stress, Lipidperoxidation und Ferroptose und reduzierte gleichzeitig Entzündungen und Fibrose. Ein Hinweis für kombinierte Strategien zur Leberernährungsunterstützung.
- Onkologie und Selol: Eine Mischung aus Selenittriglyceriden erhöhte die Aktivität antioxidativer Enzyme bei gesunden Mäusen und veränderte die Morphologie von Tumorzellen in einem Prostatakrebsmodell – es besteht mechanistisches Interesse, aber es ist weit von einer klinischen Anwendung entfernt.
- Nicht nur Se: Magnesium bei Morbus Crohn: Metaanalyse zeigte niedrigere Mg-Werte und -Aufnahme bei Patienten; Magnesiumpräparate waren mit besseren Remissionschancen und verbessertem Schlaf verbunden.
- Vitamin D bei Vorschulkindern: Eine rumänische Querschnittsstudie unterstützte die Idee, Atemwegsinfektionen durch ausreichenden Vitamin-D-Status vorzubeugen – ein Argument für saisonale Empfehlungen.
- „Nahrung als Medizin“ für die Nieren: Eine Überprüfung botanischer Mikronährstoffe (das Konzept der Medizin-Nahrungs-Homologie) systematisierte die Mechanismen des Nierenschutzes: von antioxidativen Wegen bis zur Entzündungsmodulation.
Was bedeutet das für die Praxis?
- Selen – ja, aber gezielt:
• Status einschätzen (Ernährung, Geographie, Schwerpunktgruppen),
• Darreichungsform wählen (organische Darreichungsformen und Hefe sind in der Prävention Selenit oft vorzuziehen; es wird nicht mechanisch in die Therapie übertragen!),
• Selbstdosierung vermeiden: „ein bisschen zu wenig“ und „ein bisschen zu viel“ sind durch einen schmalen Streifen getrennt. - Denken Sie über Kombinationen nach: Wo oxidativer Stress eine Rolle spielt (Leber bei MASH, Sarkopenie), sind Kombinationsansätze sinnvoll (z. B. CoQ + Se) – im Moment ist dies eine Hypothese, die auf präklinischen Daten basiert.
- Über Selen hinaus: Auch Mg- oder Vitamin-D-Mangel ist klinisch bedeutsam; gefährdete Gruppen (IBD, Kinder) profitieren von einem Status-Screening und der richtigen Nahrungsergänzung.
Wo sind jetzt die „roten Linien“?
- Selenformen ≠ austauschbare Tabletten. Nanoformen und Selenit erzeugen unterschiedliche Signale im Gewebe; Ergebnisse aus Tiermodellen sind nicht direkt auf den Menschen übertragbar.
- Assoziation ist nicht gleich Kausalität. Die meisten „menschlichen“ Daten sind Querschnittsdaten: Sie sind nützlich für Hypothesen, nicht für Rezepte. Es sind randomisierte Studien mit Einschluss-Biomarkern und „harten“ Ergebnissen erforderlich.
- Enges „Sicherheitsfenster“. Regelmäßige „Multivitamine mit Selen“ „für alle Fälle“ sind keine gute Idee: Das Risiko, ins Übermaß zu schießen, ist real, insbesondere wenn gleichzeitig sereiche Lebensmittel konsumiert werden.
Wohin soll sich die Wissenschaft bewegen: Gezielte Aufgaben für die nächsten Jahre
- Entschlüsselung der „Geheimtipps“ unter den Selenoproteinen: Funktionen wenig erforschter Proteine und ihre gewebespezifischen Rollen (Gehirn, Immunität, Fortpflanzung).
- Vergleichen Sie Formen in der Klinik: Direkter Vergleich von RCTs mit organischen Formen, Selenit und (Vorsicht) Nanoformen – mit Pharmakokinetik und Gewebemarkern der Wirkung.
- Kombinationsernährungsschemata: Se + CoQ in MASH, Se + Protein/Aminosäuren in Sarkopenie-Studien – mit gut konzipierten Endpunkten.
- Personalisierung der Dosis: Berücksichtigung der Genetik des Selenstoffwechsels, der Aminosäuren-Hintergrunddiät und der Mikrobiota zur Anpassung von Dosis und Form.
Abschluss
Die Sonderausgabe ist keine Sensation – sie bringt Ordnung in die Bereiche, in denen Selen (und andere Mikronährstoffe) wirklich sinnvoll ist und in denen es wichtig ist, keinen Schaden anzurichten. In der Praxis bedeutet dies „weniger universelle Schemata, mehr Schichtung“: den Status beurteilen, eine Form wählen, mit Mängeln arbeiten und sorgfältig Kombinationen hinzufügen, wo sie biologisch sinnvoll sind.
Quelle: Shuang-Qing Zhang. Auswirkungen der Aufnahme von Selen und anderen Mikronährstoffen auf die menschliche Gesundheit. Leitartikel zur Sonderausgabe „ Nutrients“, 7. Juli 2025; 17(13):2239. https://doi.org/10.3390/nu17132239
