
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Leises Fortschreiten bedeutet einen "radikalen Bruch" im Verständnis der Multiplen Sklerose
Zuletzt überprüft: 02.07.2025
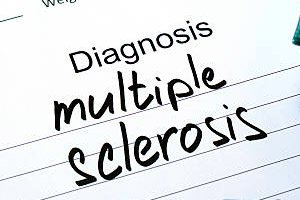 ">
">Das Fortschreiten der Behinderung unabhängig von Rückfällen (PIRA), manchmal auch als „stille Progression“ bezeichnet, ist zu einem zentralen Integrationskonzept in der modernen Sichtweise auf Multiple Sklerose (MS) geworden.
„Die Beobachtung, dass bei schubförmig remittierender Multipler Sklerose (RRMS) im Frühstadium eine Progression ohne vorherige Schübe auftreten kann, wurde nun in mehreren Kohortenstudien bestätigt und gilt als häufigste Ursache für die Progression bei Patienten mit Schub“, sagte Dr. Bruce Cree, PhD, MAS, von der University of California, San Francisco (UCSF). „Diese Beobachtung stellt einen grundlegenden Wandel in unserem Verständnis von MS dar.“
Ruhiger Fortschritt
Im Jahr 2019 schlugen Cree und Kollegen den Begriff „stille Progression“ vor, um die Anhäufung von Behinderungen zu beschreiben, die nicht mit der entzündlichen Aktivität bei MS zusammenhängen, basierend auf Daten der prospektiven EPIC-Kohorte der UCSF.
Das Team untersuchte Patienten mit schubförmiger MS im Rahmen einer Langzeitnachbeobachtung und stellte fest, dass Schübe mit einer vorübergehenden Zunahme der Behinderung über einen Zeitraum von einem Jahr (P=0,012) verbunden waren, jedoch nicht mit einer bestätigten Behinderungsprogression (P=0,551).
Darüber hinaus nahm das relative Gehirnvolumen bei Patienten mit fortschreitender Behinderung schneller ab als bei Patienten, bei denen die Behinderung stabil blieb.
Die hohe Wirksamkeit der MS-Therapie gegen klinische Schübe habe es ermöglicht, Langzeitergebnisse zu beurteilen, wenn Elemente der Herderkrankung unterdrückt worden seien, stellten die Forscher fest. Dies habe einen grundlegenden Wandel im Denken ermöglicht.
„Früher ging man davon aus, dass die Verschlechterung der Behinderung in den frühen Stadien der Krankheit auf Rückfälle zurückzuführen sei und erst später, nach einer erheblichen Anhäufung von Behinderungen, diese verschwanden“, bemerkte Cree.
„Dieses Zwei-Phasen-Modell ist falsch“, betonte er. „Was wir als sekundär progrediente MS bezeichnen, ist höchstwahrscheinlich derselbe Prozess, der auftritt, wenn die schubförmige Aktivität durch hochwirksame entzündungshemmende Medikamente unterdrückt wird.“
„Mit anderen Worten: Sekundär progrediente MS ist nicht sekundär – eine fortschreitende Verschlechterung der Behinderung tritt parallel zur schubförmigen Erkrankung auf und kann frühzeitig im Krankheitsverlauf erkannt werden“, sagte Cree.
Definition von PIRA
Im Jahr 2023 schlugen Forscher unter der Leitung von Dr. Ludwig Kappos von der Universität Basel in der Schweiz auf der Grundlage einer systematischen Überprüfung der PIRA-Literatur eine harmonisierte Definition von PIRA zur allgemeinen Verwendung vor.
„Auf die ersten Beschreibungen von PIRA folgten zahlreiche Studien an verschiedenen Patientengruppen, um dieses neue Phänomen besser zu verstehen“, sagte Co-Autor Dr. Jannis Müller, ebenfalls von der Universität Basel.
„Es gab jedoch keine einheitliche Definition von PIRA, was den Vergleich und die Interpretation von Studien erschwerte“, fuhr er fort. „Unser Ziel war es, den aktuellen Wissensstand zu diesem Phänomen zusammenzufassen und einheitliche Diagnosekriterien für die Identifizierung von PIRA vorzuschlagen.“
Kappos und Kollegen stützten ihre Kriterien auf eine Literaturrecherche von 48 Studien. Sie schätzten, dass PIRA jährlich bei etwa 5 % der Patienten mit schubförmig remittierender MS auftritt, was mindestens 50 % der Behinderungen bei schubförmig remittierender MS ausmacht. Im Gegensatz zu schubbedingten Beeinträchtigungen nahm der Anteil von PIRA mit dem Alter und der Krankheitsdauer zu.
Die Untersuchung bestätigte frühere Ergebnisse von Cree und anderen. „PIRA ist für einen Großteil der Zunahme von Behinderungen bereits in den frühesten Stadien der MS verantwortlich“, sagte Muller.
„Dies stellt die traditionelle Einteilung der MS in schubförmig-remittierende und progrediente Phänotypen in Frage und stützt die Ansicht, dass beide Mechanismen bei allen Patienten und in allen Stadien vorhanden sind, wobei sich die entzündlichen und neurodegenerativen Aspekte der Erkrankung überschneiden“, fuhr er fort. Die Berücksichtigung dieses Phänomens könne zur Entwicklung gezielter und personalisierter Therapien beitragen, fügte er hinzu.
Empfehlungen zur Diagnose von PIRA
Kappos et al. empfahlen die Verwendung einer zusammengesetzten Messung, die die Funktion der oberen Extremitäten (z. B. 9-Loch-Test), die Gehgeschwindigkeit (25-Fuß-Test) und kognitive Tests (Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung gemessen mit dem Symbol-Digit-Test) umfasst.
Zu den weiteren Empfehlungen gehörten die Verwendung von Datensätzen mit geplanten, standardisierten klinischen Bewertungen in Abständen von höchstens 12 Monaten und die Interpretation neuer oder sich vergrößernder T2-Läsionen oder Gadolinium-anreichernder Läsionen als Zeichen akuter Aktivität, die zeitlich mit einem klinischen Ereignis in Zusammenhang steht, nur dann, wenn die Bilder innerhalb von 90 Tagen aufgenommen wurden.
Kriterien für die Definition oder Diagnose von PIRA sowohl bei schubförmig remittierender als auch bei progredienter MS sollten einen Basisreferenzwert umfassen, der mit klinischen Ereignissen aktualisiert wird, eine Klassifizierung der Verschlechterung als auf PIRA zurückzuführen nur dann, wenn sie von durch Prüfer bestätigten Schüben unterschieden wird, eine Bestätigung einer nachweisbaren Verschlechterung der Behinderung 6-12 Monate nach der ersten Verschlechterung und die Anforderung einer anhaltenden PIRA für 12-24 Monate, fügten Kappos und Kollegen hinzu.
Abschluss
Seit der Einführung des Begriffs „stille Progression“ wurde PIRA aus verschiedenen Perspektiven untersucht. Eine Studie ergab, dass MS-Patienten, die kurz nach ihrem ersten demyelinisierenden Ereignis PIRA entwickelten, häufiger unter langfristigen Behinderungen litten. Eine andere Studie berichtete, dass MS-Patienten mit Beginn im Kindesalter bereits in relativ jungen Jahren an PIRA erkrankten. Forscher haben zudem vorgeschlagen, dass das Serum-Glia-Fibrillen-Säureprotein (GFAP) ebenso wie die Rückenmarksatrophie ein prognostischer Biomarker für PIRA sein könnte.
Das Verständnis von PIRA habe tiefgreifende Auswirkungen, bemerkte Cree.
„Wenn ein Medikament den Ausbruch von PIRA bei schubförmiger MS wirksam verhindern kann, wird seine Anwendung wahrscheinlich auch den Ausbruch der sogenannten sekundär progredienten MS verhindern“, sagte er. „Klinische Studien mit PIRA als primärem Endpunkt wurden bisher noch nicht erfolgreich durchgeführt, stellen aber ein neues Feld für die Bewertung der therapeutischen Wirksamkeit dar.“
