
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Fraktur des Oberkiefers
Facharzt des Artikels
Zuletzt überprüft: 07.07.2025
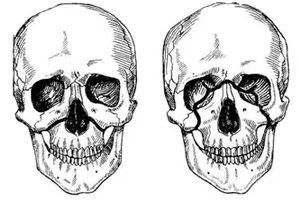
Eine Oberkieferfraktur folgt üblicherweise einer der drei typischen Linien des geringsten Widerstands, die von Le Fort beschrieben wurden: obere, mittlere und untere. Sie werden allgemein als Le-Fort-Linien bezeichnet (Le Fort, 1901).
- Le Fort I – die untere Linie – verläuft von der Basis der Apertura pyriformis horizontal zurück zum Processus pterygoideus des Keilbeins. Diese Frakturart wurde erstmals von Guérin beschrieben, und auch Le Fort erwähnt sie in seiner Arbeit. Daher sollte die Fraktur entlang der unteren Linie als Guérin-Le-Fort-Fraktur bezeichnet werden.
- Le Fort II – die Mittellinie, verläuft quer durch die Nasenbeine, den Boden der Augenhöhle, den Infraorbitalrand und dann nach unten entlang der Jochbeinnaht und des Flügelfortsatzes des Keilbeins.
- Le Fort III ist die obere Linie mit der geringsten Stärke, die quer durch die Basis der Nasenbeine, den Boden der Augenhöhle, ihren äußeren Rand, den Jochbogen und den Flügelfortsatz des Keilbeins verläuft.
Bei einer Le-Fort-I-Fraktur ist nur der Zahnbogen des Oberkiefers mitsamt dem Gaumenfortsatz beweglich; bei einer Le-Fort-II-Fraktur der gesamte Oberkiefer mit Nase und bei einer Le-Fort-III-Fraktur der gesamte Oberkiefer mit Nase und Jochbein. Die angegebene Beweglichkeit kann einseitig oder beidseitig sein. Bei einseitigen Oberkieferfrakturen ist die Beweglichkeit des Fragments weniger ausgeprägt als bei beidseitigen Frakturen.
Frakturen des Oberkiefers, insbesondere entlang der Le-Fort-III-Linie, gehen häufig mit Schäden an der Schädelbasis, Gehirnerschütterungen, Prellungen oder einer Kompression des Gehirns einher. Gleichzeitige Schäden an Kiefer und Gehirn sind häufig die Folge eines schweren und schweren Traumas: ein Schlag ins Gesicht mit einem schweren Gegenstand, eine Kompression, ein Sturz aus großer Höhe. Der Zustand von Patienten mit einer Oberkieferfraktur wird durch Schäden an den Wänden der Nasennebenhöhlen, dem Nasenrachenraum, dem Mittelohr, den Hirnhäuten, der vorderen Schädelgrube mit den darin eingetriebenen Nasenbeinen und den Wänden der Stirnhöhle erheblich verschlimmert. Infolge einer Fraktur der Wände dieser Nebenhöhle oder des Siebbeinlabyrinths kann ein Emphysem des Unterhautgewebes in Augenhöhle, Stirn und Wange auftreten, das sich durch das charakteristische Symptom des Krepitierens äußert. Häufig kommt es zu Quetschungen oder Rissen der Weichteile im Gesicht.
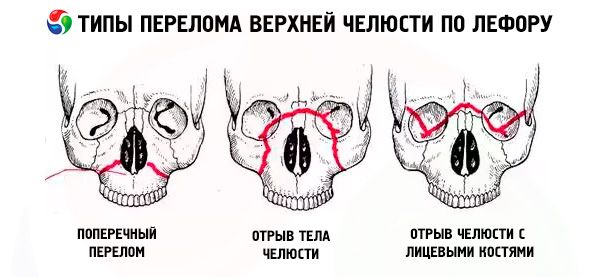
 [ 1 ]
[ 1 ]
Symptome eines Oberkieferbruchs
Frakturen der Schädelbasis gehen mit Symptomen wie „blutigen Gläsern“, subkonjunktivaler Suffusion (Blutdurchtränkung), retroaurikulärem Hämatom (bei einer Fraktur der mittleren Schädelgrube), Blutungen und insbesondere Liquorrhö aus Ohr und Nase, Funktionsstörungen der Hirnnerven und allgemeinen neurologischen Störungen einher. Am häufigsten sind die Äste des Trigeminus-, Gesichts- und Oculomotoriusnervs geschädigt (Sensibilitätsverlust, Mimikstörung, Schmerzen beim Bewegen der Augäpfel nach oben oder zur Seite usw.).
Die Geschwindigkeit der Hämatomentwicklung ist von großer diagnostischer Bedeutung: schnell – weist auf einen lokalen Ursprung hin, und langsam – über 1–2 Tage – ist typisch für indirekte, tiefe Blutungen, dh eine Fraktur der Schädelbasis.
Die Diagnose von Frakturen des Oberkiefers ist im Vergleich zu Verletzungen des Unterkiefers eine komplexere Aufgabe, da sie häufig mit einer schnell zunehmenden Schwellung der Weichteile (Augenlider, Wangen) und intrazellulären Blutungen einhergehen.
Die typischsten Symptome einer Oberkieferfraktur:
- Verlängerung oder Abflachung des mittleren Gesichtsteils aufgrund der Verschiebung des gerissenen Kiefers nach unten oder innen (nach hinten);
- Schmerzen beim Versuch, die Zähne zu schließen;
- Fehlbiss;
- Blutungen aus Nase und Mund.
Letzteres ist besonders ausgeprägt bei Frakturen entlang der Le-Fort-III-Linie. Darüber hinaus sind Frakturen des Oberkiefers häufig betroffen, was es schwierig macht, das Hauptsymptom einer Knochenfraktur zu erkennen – die Verschiebung von Fragmenten und deren pathologische Beweglichkeit. In solchen Fällen kann die Diagnose durch eine Abflachung des mittleren Gesichtsdrittels, eine Malokklusion und das Stufensymptom unterstützt werden, das durch Palpation der Ränder der Augenhöhlen, Jochbögen und Jochbeinkämme (der Bereich, in dem sich der Jochbeinfortsatz des Oberkiefers und der Oberkieferfortsatz des Jochbeins verbinden) aufgedeckt wird und durch eine Verletzung der Integrität dieser Knochenformationen verursacht wird.
Um die Genauigkeit der Diagnose von Frakturen des Oberkiefers zu erhöhen, sollte man die Schmerzen beim Abtasten der folgenden Punkte berücksichtigen, die Bereichen erhöhter Dehnbarkeit und Kompression der Knochen entsprechen:
- oberer Nasenflügel – an der Basis der Nasenwurzel;
- untere Nase - an der Basis der Nasenscheidewand;
- supraorbital – entlang der oberen Kante der Augenhöhle;
- extraorbital – am äußeren Rand der Augenhöhle;
- infraorbital - entlang der Unterkante der Augenhöhle;
- Jochbein;
- gewölbt - auf dem Jochbogen;
- tuberal - am Tuberkel des Oberkiefers;
- Jochbein-Alveolar-Bereich - oberhalb des 7. oberen Zahns;
- Eckzahn;
- Gaumen (Punkte werden von der Seite der Mundhöhle abgetastet).
Symptome der Beweglichkeit der Oberkieferfragmente und eines „schwebenden Gaumens“ können wie folgt festgestellt werden: Der Arzt greift mit den Fingern seiner rechten Hand die vordere Zahngruppe und den Gaumen und legt seine linke Hand von außen auf die Wangen; dann macht er leichte Wippbewegungen vorwärts, rückwärts und rückwärts. Bei impaktierten Frakturen kann die Beweglichkeit des Fragments auf diese Weise nicht bestimmt werden. In diesen Fällen ist es notwendig, die Flügelfortsätze der Keilbeine abzutasten; in diesem Fall verspürt der Patient normalerweise Schmerzen, insbesondere bei Frakturen entlang der Le-Fort-Linie II und III, manchmal begleitet von einer Reihe der oben genannten Symptome einer Fraktur der Schädelbasis, des Siebbeinlabyrinths, der Nasenbeine, der unteren Wände der Augenhöhlen und der Jochbeine.
Bei Patienten mit Verletzungen des Oberkiefers und des Stirnbeins sind Frakturen der Kieferhöhlenwände, des Unterkiefers und der Jochbeine, des Siebbeinlabyrinths und der Nasenscheidewand möglich. Daher kann es bei kombinierten Frakturen der Schädelbasis, des Oberkiefers, der Jochbeine, der Nasenscheidewand und der Tränenbeine zu starkem Tränenfluss und Liquorrhö aus Nase und Ohren kommen.
Die Kombination von Oberkieferfrakturen mit traumatischen Schäden an anderen Körperteilen äußert sich klinisch in den meisten Fällen in einem besonders schweren Syndrom der gegenseitigen Verschlimmerung und Überlappung. Patienten mit einer solchen Kombination sollten als Opfer mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung allgemeiner septischer Komplikationen nicht nur im Kiefer- und Gesichtsbereich, sondern auch in anderen entfernten Lokalisationsherden (infolge von Infektionsmetastasen) eingestuft werden, einschließlich geschlossener, die keine direkte anatomische Verbindung zu Kiefer, Mundhöhle und Gesicht haben.
Viele Patienten mit Oberkieferfrakturen leiden in gewissem Ausmaß an einer traumatischen Neuritis der infraorbitalen Äste des Trigeminusnervs; bei manchen Opfern kommt es über einen längeren Zeitraum zu einer verringerten elektrischen Erregbarkeit der Zähne auf der Seite der Verletzung.
Von gewisser diagnostischer Bedeutung ist die palpatorische Erkennung von Unregelmäßigkeiten an den Augenhöhlenrändern (stufenförmige Vorwölbungen), Jochbein-Alveolar-Kämmen, Nasolabialnähten sowie Veränderungen an den Oberkieferrändern bei der Röntgenaufnahme in axialer und frontaler Projektion.
Folgen von Kieferfrakturen
Der Ausgang von Kieferfrakturen hängt von vielen Faktoren ab: Alter und Allgemeinzustand des Opfers vor der Verletzung, das Vorliegen eines Syndroms der gegenseitigen Verschlimmerung, die Umweltbedingungen im Gebiet des ständigen Wohnsitzes des Opfers und insbesondere das Vorliegen eines Ungleichgewichts von Mineralstoffen in Wasser und Nahrung (GP Ruzin, 1995). So sind laut GP Ruzin bei Bewohnern verschiedener Gebiete der Region Iwano-Frankiwsk der Verlauf von Frakturen und die Art der untersuchten Stoffwechselprozesse nahezu identisch und können als optimal betrachtet werden, während in der Region Amur der Prozess der Knochengeweberegeneration und die Stoffwechselreaktionen langsamer sind. Die Häufigkeit und Art der Komplikationen hängen von der Anpassungsphase des Individuums in diesem Bereich ab. Die von ihm verwendeten Indikatoren – Entzündungsreaktionsindex (IRI), Stoffwechselindex (MI), Regenerationsindex (RI) – ermöglichen die Analyse aller Veränderungen der untersuchten Indikatoren, selbst in Fällen, in denen die Veränderungen bei jedem einzelnen von ihnen nicht über die physiologischen Normen hinausgehen. Daher ermöglicht die Verwendung der Indizes IVR, MI und RI, den Verlauf einer Fraktur und die Entwicklung einer entzündlich-infektiösen Komplikation vorherzusagen, einen Behandlungsplan für einen Patienten zu erstellen, um Stoffwechselprozesse zu optimieren, Komplikationen vorzubeugen und die Behandlungsqualität unter Berücksichtigung der Eigenschaften und äußeren Bedingungen des Patienten zu überwachen. Für die Region Iwano-Frankiwsk lauten die kritischen Werte der Indizes beispielsweise: IVR – 0,650, MI – 0,400, RI – 0,400. Wenn niedrigere Werte erreicht werden, ist eine korrigierende Therapie erforderlich. Eine Stoffwechseloptimierung ist nicht erforderlich, wenn IVR > 0,6755, MI > 0,528, RI > 0,550. Der Autor hat festgestellt, dass die Indexwerte in verschiedenen Regionen je nach medizinisch-geografischen und biogeochemischen Bedingungen, die bei ihrer Analyse berücksichtigt werden müssen, variieren können. So sind diese Werte in der Region Amur niedriger als in der Region Iwano-Frankiwsk. Aus diesem Grund ist es ratsam, in den ersten 2–4 Tagen nach der Verletzung eine Beurteilung von IVR, MI und RI in Verbindung mit einer klinischen und radiologischen Untersuchung des Patienten durchzuführen, um das anfängliche Regenerationspotenzial zu ermitteln und die erforderliche Korrekturtherapie zu verschreiben, am 10.–12. Tag, um die durchgeführte Behandlung zu klären und am 20.–22. Tag, um die Behandlungsergebnisse zu analysieren und die Merkmale der Rehabilitation vorherzusagen.
Laut GP Ruzin ist es in Regionen mit Hypo- und Unwohlsein, einem Ungleichgewicht der Mineralkomponenten und der Aminosäurezusammensetzung von Proteinen während der Anpassungsphase notwendig, Anabolika und Adaptogene in den Behandlungskomplex einzubeziehen. Unter allen von ihm verwendeten physikalischen Faktoren hatte die Laserstrahlung den stärksten positiven Effekt.
Basierend auf seiner Forschung fasst der Autor praktische Empfehlungen wie folgt zusammen:
- Es empfiehlt sich, Tests zu verwenden, die den Stoffwechselzustand und den Reparaturprozess charakterisieren: Entzündungsreaktionsindex (IRI), Stoffwechselindex (MI), Regenerationsindex (RI).
- Bei einem IVR unter 0,675 ist der Einsatz osteotroper Antibiotika notwendig, bei einem IVR über 0,675 ist bei rechtzeitiger und ausreichender Ruhigstellung eine Antibiotikatherapie nicht angezeigt.
- Liegen die MI- und RI-Werte unter 0,400, ist eine Therapie erforderlich, die einen Komplex aus Medikamenten und Wirkstoffen umfasst, die den Protein- und Mineralstoffwechsel anregen.
- Bei niedrigen IVR-Werten ist der Einsatz lokaler thermischer Verfahren (UHF) kontraindiziert, bis der Entzündungsherd abgeklungen oder drainiert ist.
- Bei der Behandlung von Patienten mit Unterkieferfrakturen unter ungünstigen medizinischen und geografischen Bedingungen, insbesondere während der Anpassungsphase, sollten Adaptogene, Anabolika und Antioxidantien verschrieben werden.
- Um das Infiltrat schnell aufzulösen und die Schmerzdauer zu verkürzen, empfiehlt sich in den ersten 5-7 Tagen nach der Verletzung eine Laserbestrahlung.
- Um die Behandlung von Patienten mit einer Unterkieferfraktur zu optimieren und die Dauer des Krankenhausaufenthalts zu verkürzen, ist es notwendig, Rehabilitationsräume einzurichten und die Kontinuität in allen Phasen der Behandlung sicherzustellen.
Bei rechtzeitiger präklinischer, medizinischer und fachärztlicher Versorgung sind die Ergebnisse von Kieferfrakturen bei Erwachsenen günstig. So konnte beispielsweise VF Chistyakova (1980) durch die Verwendung eines Antioxidantienkomplexes zur Behandlung unkomplizierter Unterkieferfrakturen die Krankenhausaufenthaltsdauer der Patienten um 7,3 Betttage verkürzen, und VV Lysenko (1993) reduzierte bei der Behandlung offener Frakturen, d. h. offensichtlich mit oraler Mikroflora infizierter Frakturen, durch intraorales Nitazol-Schaum-Aerosol den Prozentsatz traumatischer Osteomyelitis um das 3,87-fache und verkürzte gleichzeitig die Dauer der Antibiotika-Einnahme. Laut KS Malikov (1983) wurde beim Vergleich des Röntgenbildes des Prozesses der reparativen Regeneration des Unterkiefers mit autoradiographischen Indizes ein spezifisches Muster im Knochenmineralstoffwechsel festgestellt: Eine Zunahme der Intensität des Einschlusses der radioaktiven Isotope 32 P und 45 Ca in das Knochenregenerat des beschädigten Unterkiefers geht mit dem Auftreten radiologisch sichtbarer Verkalkungsbereiche in den Endabschnitten der Fragmente einher; die Dynamik der Absorption von Radiopharmaka erfolgt in Form von zwei Phasen maximaler Konzentration markierter Verbindungen 32 P und 45 Ca in der Verletzungszone. Während die Knochenfragmente bei Frakturen des Unterkiefers heilen, nimmt die Intensität des Einschlusses der Isotope 32 P und 45 Ca in der Verletzungszone zu. Die maximale Konzentration osteotroper radioaktiver Verbindungen in den Endabschnitten der Fragmente wird am 25. Tag nach der Kieferverletzung beobachtet. Die Anreicherung von Makro- und Mikroelementen in den Endabschnitten der Unterkieferfragmente hat einen phasischen Charakter. Der erste Anstieg der Mineralstoffkonzentration wird an den Tagen 10–25, der zweite an den Tagen 40–60 beobachtet. In späteren Stadien der reparativen Regeneration (120 Tage) nähert sich der Mineralstoffwechsel in der Frakturzone allmählich den Normalwerten an und ist am 360. Tag vollständig normalisiert, was dem Prozess der endgültigen Reorganisation des Knochenkallus entspricht, der die Unterkieferfragmente verband. Der Autor stellte fest, dass eine rechtzeitige und korrekte anatomische Ausrichtung der Fragmente und ihre zuverlässige chirurgische Fixierung (z. B. mit einer Knochennaht) zu einer frühen (25 Tage) Knochenfusion der Unterkieferfragmente und zur Wiederherstellung (nach 4 Monaten) der normalen Struktur des neu gebildeten Knochengewebes führt. Seine Untersuchung mit biochemischen und spektralen Forschungsmethoden im Vergleich mit morphologischen und autoradiographischen Daten zeigte, dass der Sättigungsgrad der Kallus-Mikrostrukturen mit Mineralien mit zunehmender Reife des Knochengewebes allmählich zunimmt.
Bei nicht rechtzeitiger Anwendung einer komplexen Behandlung können die oben genannten und andere entzündliche Komplikationen (Sinusitis, Arthritis, wanderndes Granulom usw.) auftreten, es kann zur Bildung falscher Gelenke kommen, es kann zu kosmetischen Entstellungen des Gesichts kommen, es können Kau- und Sprachstörungen auftreten und es können andere nicht entzündliche Erkrankungen auftreten, die eine komplexe und langfristige Behandlung erfordern.
Bei mehreren Kieferfrakturen im Alter und bei senilen Personen werden häufig eine verzögerte Fusion, Pseudoarthrose, Osteomyelitis usw. beobachtet.
In einigen Fällen erfordert die Behandlung posttraumatischer Komplikationen den Einsatz komplexer orthopädischer Strukturen entsprechend der Art der funktionellen und anatomisch-kosmetischen Störungen sowie rekonstruktive Operationen (Osteoplastie, Refraktion und Osteosynthese, Arthroplastik usw.).
Diagnose einer Fraktur des Oberkiefers
Die Röntgendiagnostik von Oberkieferfrakturen ist oft sehr schwierig, da die Röntgenaufnahmen in der seitlichen Projektion eine Überlagerung zweier Oberkieferknochen zeigen. Daher werden Röntgenaufnahmen des Oberkiefers in der Regel nur in einer (sagittalen) Projektion (Übersichtsröntgen) angefertigt, wobei auf die Konturen des Jochbeinkamms, des Infraorbitalrandes und der Grenzen der Kieferhöhlen geachtet werden sollte. Ihre Verletzung (Knicke und Zickzacklinien) weist auf eine Oberkieferfraktur hin.
Bei einer kraniofazialen Disjunktion (Fraktur entlang der Le-Fort-III-Linie) ist die Röntgenaufnahme des Gesichtsschädels in axialer Projektion eine große Hilfe bei der Diagnosestellung. In den letzten Jahren werden auch Tomographie und Panoramaröntgen erfolgreich eingesetzt.
In den letzten Jahren sind Diagnosetechnologien (Computertomographie, Magnetresonanztomographie) erschienen, die die gleichzeitige Diagnose von Schäden an Gesichts- und Schädelknochen ermöglichen. So unterteilten Y. Raveh et al. (1992), T. Vellemin, I. Mario (1994) Frakturen der Stirn-, Oberkiefer-, Siebbein- und Augenhöhle in zwei Typen und einen Subtyp - (1a). Typ I umfasst frontonasale Siebbein- und mediale Orbitalfrakturen ohne Schäden an den Knochen der Schädelbasis. Beim Subtyp 1a kommen zusätzlich Schäden an der medialen Wand des Sehnervenkanals und eine Kompression des Sehnervs hinzu.
Typ II umfasst frontal-nasal-ethmoidale und mediale orbitale Frakturen der Schädelbasis. In diesem Fall sind die inneren und äußeren Teile des Gesichts- und Schädels geschädigt, mit intrakranieller Verschiebung der hinteren Stirnhöhlenwand, des vorderen Teils der Schädelbasis, der oberen Augenhöhlenwand, des Schläfen- und Keilbeins sowie der Sella-turcica-Region. Es kommt zu Rupturen der Dura mater. Diese Art von Verletzung ist gekennzeichnet durch Liquorleckage, Hernienvorwölbung von Hirngewebe aus dem Frakturspalt, Bildung eines beidseitigen Telekanthus mit Ausbreitung der Interorbitalregion sowie Kompression und Schädigung des Sehnervs.
Eine derart detaillierte Diagnostik komplexer kraniofazialer Traumata ermöglicht 10–20 Tage nach der Verletzung einen gleichzeitigen Vergleich der Knochenfragmente der Schädelbasis und des Gesichts, wodurch die Krankenhausaufenthaltsdauer der Opfer und die Zahl der Komplikationen verkürzt werden können.
Was muss untersucht werden?
Wen kann ich kontaktieren?
Hilfe für Opfer von Kiefer- und Gesichtstraumata
Die Behandlung von Patienten mit Kieferfrakturen besteht darin, die verlorene Form und Funktion so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Lösung dieses Problems umfasst die folgenden Hauptphasen:
- Ausrichtung verschobener Fragmente,
- Sichern Sie sie in der richtigen Position.
- Stimulation der Knochengeweberegeneration im Frakturbereich;
- Vorbeugung verschiedener Arten von Komplikationen (Osteomyelitis, Pseudoarthrose, traumatische Sinusitis, perimaxilläre Phlegmone oder Abszesse usw.).
Eine spezialisierte Behandlung von Kieferfrakturen sollte so früh wie möglich (in den ersten Stunden nach der Verletzung) erfolgen, da eine rechtzeitige Neupositionierung und Fixierung der Fragmente günstigere Bedingungen für die Knochenregeneration und Heilung beschädigter Weichteile der Mundhöhle bietet und auch dazu beiträgt, primäre Blutungen zu stoppen und die Entwicklung entzündlicher Komplikationen zu verhindern.
Die Organisation der Hilfeleistung für Opfer mit Kiefer- und Gesichtsverletzungen muss die Kontinuität der medizinischen Maßnahmen entlang des gesamten Weges des Opfers vom Unfallort bis zur medizinischen Einrichtung mit obligatorischer Evakuierung zum Zielort gewährleisten. Umfang und Art der geleisteten Hilfeleistung können je nach Situation am Unfallort und Standort der medizinischen Zentren und Einrichtungen variieren.
Man unterscheidet zwischen:
- Erste Hilfe, die direkt am Unfallort, an Sanitätsposten geleistet wird und von Opfern (in der Reihenfolge der Selbst- oder gegenseitigen Hilfe), einem Sanitäter oder einem medizinischen Ausbilder durchgeführt wird;
- prämedizinische Versorgung durch einen Rettungssanitäter oder eine Krankenschwester, die die Erste-Hilfe-Maßnahmen ergänzen soll;
- Erste medizinische Hilfe, die möglichst innerhalb von 4 Stunden nach der Verletzung geleistet werden sollte; sie wird von nicht spezialisierten Ärzten (in ländlichen Bezirkskrankenhäusern, medizinischen Zentren und Rettungsstationen) durchgeführt;
- qualifizierte chirurgische Versorgung, die spätestens 12-18 Stunden nach der Verletzung in medizinischen Einrichtungen erfolgen muss;
- Spezialbehandlung, die innerhalb eines Tages nach der Verletzung in einer spezialisierten Einrichtung durchgeführt werden muss. Die angegebenen Zeiträume für die verschiedenen Behandlungsarten sind optimal.
 [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]
[ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]
Erste Hilfe vor Ort
Der Behandlungserfolg bei Kiefer- und Gesichtsverletzungen hängt maßgeblich von der Qualität und Aktualität der Ersten Hilfe ab. Nicht nur die Gesundheit, sondern manchmal auch das Leben des Verletzten, insbesondere bei Blutungen oder Erstickung, hängt von der richtigen Organisation ab. Ein Hauptmerkmal von Kiefer- und Gesichtsverletzungen ist oft die Diskrepanz zwischen dem Typ des Verletzten und der Schwere der Verletzung. Es ist notwendig, die Bevölkerung durch Gesundheitserziehung (beim Roten Kreuz, im Rahmen von Zivilschutzkursen) auf dieses Problem aufmerksam zu machen.
Der medizinische Dienst sollte der Ausbildung in Erster-Hilfe-Techniken große Aufmerksamkeit schenken, insbesondere für Arbeitnehmer in Branchen, in denen die Verletzungsrate recht hoch ist (Bergbau, Landwirtschaft usw.).
Bei der Erstversorgung eines Opfers mit einer Gesichtsverletzung am Unfallort ist es zunächst notwendig, das Opfer in eine Position zu bringen, die eine Erstickung verhindert, d. h. es auf die Seite zu legen und den Kopf in Richtung der Verletzung oder mit dem Gesicht nach unten zu drehen. Anschließend sollte ein aseptischer Verband auf die Wunde gelegt werden. Bei Verätzungen des Gesichts (Säuren oder Laugen) ist es notwendig, die verbrannte Oberfläche sofort mit kaltem Wasser zu waschen, um die Reste der Substanzen zu entfernen, die die Verbrennung verursacht haben.
Nach der Erstversorgung am Unfallort (Sanitätsposten) wird der Verletzte zu einer Sanitätsstation evakuiert, wo die Erste Hilfe durch medizinisches Mittelpersonal erfolgt.
Viele Patienten mit Kiefer- und Gesichtsverletzungen können selbstständig medizinische Zentren in der Nähe des Unfallorts (Gesundheitszentren von Fabriken, Werken) erreichen. Opfer, die sich nicht selbstständig bewegen können, werden unter Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung von Erstickung und Blutungen in medizinische Einrichtungen transportiert.
Bei Verletzungen im Kiefer- und Gesichtsbereich kann Erste Hilfe durch zum Unfallort gerufenes medizinisches Mittelpersonal geleistet werden.
 [ 9 ]
[ 9 ]
Erste Hilfe
Wie die Notfallhilfe wird auch die lebensrettende Hilfe am Unfallort, in Sanitätsstationen, Gesundheitszentren, Sanitäts- und Sanitäts-Geburtshilfestationen geleistet. In diesem Fall sollten die Bemühungen in erster Linie darauf abzielen, Blutungen zu stoppen und Erstickung und Schock zu verhindern.
Medizinisches Fachpersonal mittlerer Ebene (Zahntechniker, Rettungssanitäter, Hebammen, Krankenschwestern) muss die Grundlagen der Diagnose von Gesichtsverletzungen, Elemente der Ersten Hilfe und die Besonderheiten des Patiententransports kennen.
Der Umfang der präklinischen Versorgung hängt von der Art der Verletzung, dem Zustand des Patienten, der Umgebung, in der die Versorgung erfolgt, und der Qualifikation des medizinischen Personals ab.
Das medizinische Personal muss Zeitpunkt, Ort und Umstände der Verletzung feststellen, nach der Untersuchung des Opfers eine vorläufige Diagnose stellen und eine Reihe therapeutischer und vorbeugender Maßnahmen durchführen.
Blutungen bekämpfen
Das dichte Netz an Blutgefäßen im Kiefer- und Gesichtsbereich begünstigt die Entstehung von Blutungen bei Gesichtsverletzungen. Blutungen können nicht nur nach außen oder in die Mundhöhle, sondern auch in die Tiefe des Gewebes (latent) austreten.
Bei Blutungen aus kleinen Gefäßen kann die Wunde tamponiert und ein Druckverband angelegt werden (sofern dadurch keine Erstickungsgefahr oder die Verschiebung von Kieferfragmenten besteht). Ein Druckverband kann bei den meisten Verletzungen im Kiefer- und Gesichtsbereich Blutungen stillen. Bei Verletzungen großer Äste der A. carotis externa (lingual, facial, maxillaris, temporalis superficialis) können vorübergehende Blutungen in der Notfallversorgung durch Fingerdruck gestillt werden.
Prävention von Asphyxie und Methoden zu ihrer Bekämpfung
Zunächst ist es notwendig, den Zustand des Patienten richtig einzuschätzen und dabei auf die Art seiner Atmung und Position zu achten. In diesem Fall kann eine Asphyxie festgestellt werden, deren Mechanismus unterschiedlich sein kann:
- Verschiebung der Zunge nach hinten (Luxation);
- Verschluss des Tracheallumens durch Blutgerinnsel (obstruktiv);
- Kompression der Luftröhre durch Hämatom oder ödematöses Gewebe (stenotisch);
- Verschluss des Kehlkopfeingangs mit einem herabhängenden Weichteillappen vom Gaumen oder der Zunge (valvulär);
- Einatmen von Blut, Erbrochenem, Erde, Wasser usw. (Aspiration).
Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, sollte der Patient sitzen, leicht nach vorne gebeugt und mit gesenktem Kopf; bei schweren Mehrfachverletzungen und Bewusstlosigkeit sollte er auf dem Rücken liegen und den Kopf zur Verletzungsstelle oder zur Seite drehen. Wenn die Verletzung es erlaubt, kann der Patient mit dem Gesicht nach unten liegen.
Die häufigste Ursache für Asphyxie ist die Zungenretraktion. Diese tritt auf, wenn der Unterkieferkörper, insbesondere das Kinn, bei doppelten mentalen Frakturen gequetscht wird. Eine wirksame Methode zur Bekämpfung dieser (dislozierten) Asphyxie ist die Fixierung der Zunge mit einer Seidenligatur oder das Durchstechen mit einer Sicherheits- oder Haarnadel. Um einer obstruktiven Asphyxie vorzubeugen, ist eine sorgfältige Untersuchung der Mundhöhle und die Entfernung von Blutgerinnseln, Fremdkörpern, Schleim, Speiseresten oder Erbrochenem erforderlich.
Anti-Schock-Maßnahmen
Zu den oben genannten Maßnahmen sollten vor allem die rechtzeitige Blutstillung, die Beseitigung der Asphyxie und die Durchführung einer Transportimmobilisierung gehören.
Die Schockbekämpfung bei Verletzungen im Kiefer- und Gesichtsbereich umfasst eine ganze Reihe von Maßnahmen, die auch bei Schocks aufgrund von Verletzungen anderer Körperregionen durchgeführt werden.
Um eine weitere Infektion der Wunde zu verhindern, muss ein aseptischer (schützender) Mullverband (z. B. eine Einzelpackung) angelegt werden. Es ist zu beachten, dass bei Gesichtsknochenfrakturen der Verband nicht zu fest angezogen werden sollte, um eine Verschiebung der Fragmente zu vermeiden, insbesondere bei Frakturen des Unterkiefers.
Dem medizinischen Personal der mittleren Ebene ist das Nähen von Weichteilwunden bei Gesichtsverletzungen untersagt. Bei offenen Wunden im Kiefer- und Gesichtsbereich, einschließlich aller Kieferfrakturen im Zahnbogenbereich, ist in dieser Phase der Hilfeleistung die Verabreichung von 3000 AE Bezredko-Antitetanusserum obligatorisch.
Zur Transportimmobilisierung werden Fixierverbände angelegt – ein normaler Mullverband, ein schlingenartiger Verband, ein Zirkelverband, ein starrer Kinnverband oder ein Standard-Transportverband bestehend aus Kinnverband und weicher Kopfhaube.
Wenn der Arzt nicht über diese Standardmittel verfügt, kann er eine normale Mullbinde (Hippokratische Kappe) in Kombination mit einer Mullbinde in Schlingenform verwenden. In Fällen, in denen der Patient jedoch über eine längere Strecke in eine spezialisierte Einrichtung transportiert wird, ist die Anwendung einer Gipsbinde in Schlingenform zweckmäßiger.
Es ist notwendig, die Überweisung an die medizinische Einrichtung klar auszufüllen, alle Behandlungen des Patienten anzugeben und die richtige Transportmethode sicherzustellen.
Wenn die Anamnese auf eine Bewusstlosigkeit schließen lässt, sollten Untersuchung, Hilfeleistung und Transport ausschließlich im Liegen erfolgen.
Die Ausstattung der Erste-Hilfe-Station muss alles umfassen, was zur Erstversorgung bei Gesichtsverletzungen erforderlich ist, einschließlich der Versorgung des Patienten mit Nahrung und Durst (Trinkbecher etc.).
Bei einem Massenzustrom von Opfern (aufgrund von Unfällen, Katastrophen usw.) ist deren korrekte Evakuierung und Transportsortierung (durch einen Sanitäter oder eine Krankenschwester) sehr wichtig, d. h. die Festlegung der Evakuierungsreihenfolge und die Bestimmung der Position der Opfer während des Transports.
 [ 10 ]
[ 10 ]
Erste Hilfe
Die Erste medizinische Hilfe wird von Ärzten der regionalen, regionalen und ländlichen Bezirkskrankenhäuser sowie der zentralen, regionalen und städtischen medizinischen Gesundheitszentren usw. geleistet.
Die Hauptaufgabe besteht hierbei darin, lebensrettende Hilfe zu leisten: Blutungen, Erstickungsanfälle und Schockzustände zu bekämpfen, bereits angelegte Verbände zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren oder zu ersetzen.
Die Blutungsbekämpfung erfolgt durch Abbinden der Wundgefäße oder durch dichtes Tamponieren. Bei massiven Blutungen aus der „Mundhöhle“, die mit herkömmlichen Mitteln nicht gestoppt werden können, muss der Arzt dringend eine Tracheotomie durchführen und Mundhöhle und Rachenraum dicht tamponieren.
Treten Erstickungsanzeichen auf, richten sich die Behandlungsmaßnahmen nach der Ursache. Bei einer Luxationsasphyxie wird die Zunge vernäht. Eine gründliche Untersuchung der Mundhöhle und die Entfernung von Blutgerinnseln und Fremdkörpern beseitigen die Gefahr einer obstruktiven Asphyxie. Sollte trotz der angezeigten Maßnahmen weiterhin eine Asphyxie auftreten, ist eine dringende Tracheotomie angezeigt.
Anti-Schock-Maßnahmen werden nach den allgemeinen Regeln der Notfallchirurgie durchgeführt.
Anschließend ist bei Kieferfrakturen das Anlegen eines Fixierverbandes zur transportbedingten (vorübergehenden) Ruhigstellung und die Gabe von Getränken auf gewohnte Weise oder mittels eines Trinkbechers mit einem am Ausguss befestigten Gummischlauch erforderlich.
Methoden zur temporären Fixierung von Kieferfragmenten
Derzeit gibt es folgende Methoden zur temporären (Transport-)Immobilisierung von Kieferfragmenten:
- Kinnschlingen;
- schlingenartiges Pflaster oder Heftpflaster;
- intermaxilläre Ligatur mit Draht oder Kunststofffaden;
- Standardsatz und andere. Beispielsweise fortlaufende Achterligatur, Lingual-Labialligatur, Y. Galmosh-Ligatur, fortlaufende Drahtligatur nach Stout, Ridson, Obwegeser, Elenk, recht gut beschrieben von Y. Galmosh (1975).
Die Wahl der Methode zur vorübergehenden Ruhigstellung von Fragmenten richtet sich nach der Lage der Frakturen, ihrer Anzahl, dem Allgemeinzustand des Opfers und dem Vorhandensein ausreichend stabiler Zähne zur Befestigung der Schiene oder des Verbandes.
Bei einer Fraktur des Alveolarfortsatzes im Ober- oder Unterkiefer wird nach der Ausrichtung der Fragmente meist ein äußerer, schlingenartiger Mullverband angelegt, der den Unterkiefer an den Oberkiefer presst.
Bei allen Frakturen des Oberkieferkörpers wird nach der Reposition der Fragmente ein Metallschienenlöffel von AA Limberg auf den Oberkiefer gelegt oder ein schlingenartiger Verband auf den Unterkiefer angelegt.
Wenn im Oberkiefer keine Zähne vorhanden sind, wird eine Auskleidung aus Stens oder Wachs auf das Zahnfleisch aufgebracht.
Trägt der Patient eine Zahnprothese, dient diese als Abstandshalter zwischen den Zahnbögen und wird zusätzlich mit einem schlingenartigen Verband versorgt. Im vorderen Bereich der Kunststoffzahnreihen muss mit einem Fräser ein Loch für die Tülle eines Trinkbechers, Drainageschlauchs oder Teelöffels gebohrt werden, um dem Patienten die Nahrungsaufnahme zu ermöglichen.
Sind in beiden Kiefern Zähne vorhanden, werden bei Frakturen des Unterkieferkörpers die Fragmente mit einem intermaxillären Ligaturverband, einer starren Standardschlinge oder einer Gipsschiene verstärkt, die auf den Unterkiefer aufgelegt und am Schädelgewölbe befestigt wird.
Bei Frakturen im Bereich der Kondylenfortsätze des Unterkiefers wird eine intraorale Ligatur oder ein starrer Verband mit elastischem Zug an der Schädeldecke des Betroffenen angelegt. Bei Frakturen der Kondylenfortsätze mit Malokklusion (offen) wird der Unterkiefer mit einem Platzhalter zwischen den letzten antagonisierenden großen Backenzähnen fixiert. Sind im beschädigten Unterkiefer keine Zähne vorhanden, kann eine Prothese in Kombination mit einer starren Schlinge verwendet werden; ist keine Prothese vorhanden, wird eine starre Schlinge oder ein zirkulärer Mullverband verwendet.
Bei kombinierten Frakturen des Ober- und Unterkiefers kommen die oben beschriebenen Methoden der getrennten Fixierung der Fragmente zum Einsatz, beispielsweise die Rauer-Urbanskaya-Löffelschiene in Kombination mit einer Ligaturbindung der Zähne an den Enden der Unterkieferfragmente. Die Ligatur sollte zwei Zähne jedes Fragments in Form einer Acht abdecken. Wenn keine Gefahr von intraoralen Blutungen, Zungenretraktion, Erbrechen etc. besteht, kann eine starre Schlinge verwendet werden.
In der Phase der Ersten Hilfe ist es notwendig, den Zeitpunkt und die Art des Transports des Opfers richtig zu bestimmen und, wenn möglich, den Evakuierungszweck festzulegen. Bei komplizierten und multiplen Frakturen der Gesichtsknochen ist es ratsam, die Anzahl der „Evakuierungsphasen“ auf ein Minimum zu reduzieren und solche Patienten direkt in stationäre Kiefer- und Gesichtsabteilungen republikanischer, regionaler und provinzieller (städtischer) Krankenhäuser zu überweisen.
Bei kombinierten Traumata (insbesondere Schädeltraumata) sollte die Frage des Patiententransports sorgfältig, wohlüberlegt und in Absprache mit den entsprechenden Spezialisten entschieden werden. In diesen Fällen ist es sinnvoller, Spezialisten aus regionalen oder städtischen Einrichtungen zur Konsultation in das Kreiskrankenhaus zu holen, als Patienten mit Gehirnerschütterung oder Hirnprellung dorthin zu transportieren.
Wenn im örtlichen Krankenhaus ein Zahnarzt vorhanden ist, kann die Erste Hilfe bei Erkrankungen wie nicht penetrierenden Verletzungen der Weichteile des Gesichts, die keine primäre plastische Chirurgie erfordern, Zahnfrakturen, Frakturen der Alveolarfortsätze des Ober- und Unterkiefers, unkomplizierten einzelnen Frakturen des Unterkiefers ohne Verschiebung, Frakturen der Nasenbeine, die keine Reposition erfordern, Luxationen des Unterkiefers, die erfolgreich reponiert wurden, Gesichtsverbrennungen ersten und zweiten Grades durch Elemente einer spezialisierten Versorgung ergänzt werden.
Patienten mit kombiniertem Gesichtstrauma, insbesondere bei einer Gehirnerschütterung, sollten in Bezirkskrankenhäusern stationär aufgenommen werden. Bei der Entscheidung über den Transport in den ersten Stunden nach der Verletzung in spezialisierte Abteilungen sollten der Allgemeinzustand des Patienten, die Transportart, der Straßenzustand und die Entfernung zur medizinischen Einrichtung berücksichtigt werden. Als am besten geeignete Transportart für diese Patienten gelten Hubschrauber und, bei gutem Straßenzustand, spezialisierte Krankenwagen.
Nach der Erstversorgung im Kreiskrankenhaus werden Patienten mit Ober- und Unterkieferfrakturen, multiplen Gesichtsknochentraumata, die durch Traumata jeglicher Lokalisation kompliziert sind, penetrierenden und ausgedehnten Weichteilschäden, die eine primäre plastische Operation erfordern, an Fachabteilungen des Kreis-, Stadt- oder Regionalkrankenhauses überwiesen. Wohin der Patient geschickt werden soll – ins Kreiskrankenhaus (sofern dort Zahnärzte vorhanden sind) oder in die Kiefer- und Gesichtsabteilung des nächstgelegenen Krankenhauses – wird je nach den örtlichen Gegebenheiten entschieden.
Qualifizierte chirurgische Versorgung
Qualifizierte chirurgische Versorgung wird von Chirurgen und Traumatologen in Ambulanzen, Traumazentren, chirurgischen oder traumatischen Abteilungen von Stadt- oder Kreiskrankenhäusern geleistet. Sie sollte in erster Linie denjenigen Opfern gewährt werden, die sie aus lebenswichtigen Gründen benötigen. Dazu gehören Patienten mit Schocksymptomen, Blutungen, akutem Blutverlust und Asphyxie. Wenn beispielsweise bei unstillbaren Blutungen aus großen Gefäßen der Kiefer- und Gesichtsregion oder bei Blutungen, die in früheren Stadien aufgetreten sind, eine zuverlässige Ligatur des blutenden Gefäßes nicht möglich ist, wird die äußere Halsschlagader auf der entsprechenden Seite ligiert. In dieser Versorgungsphase werden alle Opfer mit Verletzungen der Kiefer- und Gesichtsregion in drei Gruppen eingeteilt.
Die erste Gruppe besteht aus Patienten, die lediglich chirurgische Hilfe benötigen (Weichteilverletzungen ohne echte Defekte, Verbrennungen ersten und zweiten Grades, Erfrierungen im Gesicht). Für sie ist diese Behandlungsphase die letzte.
Die zweite Gruppe besteht aus Patienten, die eine spezielle Behandlung benötigen (Weichteilverletzungen, die eine plastische Operation erfordern; Schäden an den Gesichtsknochen; Verbrennungen dritten und vierten Grades sowie Erfrierungen im Gesicht, die eine chirurgische Behandlung erfordern); nach der Notfallversorgung werden sie in Kiefer- und Gesichtskliniken transportiert.
Zur dritten Gruppe zählen nicht transportfähige Opfer sowie Personen mit kombinierten Verletzungen anderer Körperregionen (insbesondere Schädel-Hirn-Trauma), die hinsichtlich des Schweregrads führend sind.
Einer der Gründe für wiederholte chirurgische Wundbehandlungen ist der Eingriff ohne vorherige Röntgenuntersuchung. Bei Verdacht auf Gesichtsknochenfrakturen ist dies zwingend erforderlich. Die erhöhte Regenerationsfähigkeit des Gesichtsgewebes ermöglicht chirurgische Eingriffe mit maximaler Gewebeschonung.
Bei der qualifizierten chirurgischen Versorgung von Opfern der Gruppe II, die in spezialisierte medizinische Einrichtungen überwiesen werden (sofern keine Kontraindikationen für den Transport vorliegen), muss der Chirurg:
- eine Langzeitanästhesie der Frakturstelle durchzuführen; oder noch besser – eine Langzeitanästhesie der gesamten Gesichtshälfte, entweder nach der Methode von P. Yu. Stolyarenko (1987): durch eine Nadelinjektion unter den Knochenvorsprung an der Unterkante des Jochbogens an der Verbindung des Schläfenfortsatzes des Jochbeins mit dem Jochbeinfortsatz des Schläfenbeins;
- Antibiotika in die Wunde spritzen, Antibiotika innerlich verabreichen;
- führen Sie die einfachste Transportimmobilisierung durch, z. B. das Anlegen eines Standard-Transportverbandes;
- Stellen Sie sicher, dass es während des Transports nicht zu Blutungen aus der Wunde, Erstickung oder Erstickungsgefahr kommt.
- die Verabreichung von Antitetanusserum überwachen;
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Transports zu einer spezialisierten medizinischen Einrichtung in Begleitung von medizinischem Personal (Bestimmung der Transportart, der Position des Patienten);
- Geben Sie in den Begleitdokumenten klar und deutlich an, was alles mit dem Patienten gemacht wurde.
In Fällen, in denen Kontraindikationen für die Verlegung des Opfers in eine andere medizinische Einrichtung (Gruppe III) vorliegen, wird ihm in der chirurgischen Abteilung unter Einbeziehung von Zahnärzten aus Krankenhäusern oder Kliniken qualifizierte Hilfe geleistet, die verpflichtet sind
Allgemeinchirurgen und Traumatologen wiederum müssen mit den Grundlagen der Hilfeleistung bei Traumata im Kiefer- und Gesichtsbereich vertraut sein, die Grundsätze der chirurgischen Behandlung von Gesichtswunden einhalten und die grundlegenden Methoden der Transportimmobilisierung von Frakturen kennen.
Die Behandlung von Opfern mit kombinierten Wunden im Gesicht und anderen Bereichen in einem chirurgischen (traumatologischen) Krankenhaus sollte unter Beteiligung eines Kieferchirurgen erfolgen.
Verfügt ein Bezirkskrankenhaus über eine Kiefer- und Gesichtsabteilung oder eine Zahnarztpraxis, ist der Abteilungsleiter (Zahnarzt) für den Zustand und die Organisation der traumatologischen Zahnversorgung im Bezirk verantwortlich. Zur korrekten Erfassung von Kiefer- und Gesichtstraumata muss der Zahnarzt Kontakt zu den Sanitätsstationen und Bezirkskrankenhäusern aufnehmen. Darüber hinaus sollte eine Analyse der Behandlungsergebnisse von Patienten mit Gesichtstraumata in Bezirks- und Regionaleinrichtungen durchgeführt werden.
Patienten mit komplexen und komplizierten Gesichtsverletzungen werden an die Abteilung für Kiefer- und Gesichtschirurgie überwiesen, wenn eine primäre Weichteilplastik erforderlich ist und die neuesten Methoden zur Behandlung von Gesichtsknochenfrakturen, einschließlich primärer Knochentransplantationen, zum Einsatz kommen.
Spezialisierte Notfallversorgung und Nachbehandlung bei Oberkieferfrakturen
Diese Art der Versorgung wird in stationären Kiefer- und Gesichtsabteilungen republikanischer, regionaler, provinzieller und städtischer Krankenhäuser, in Kliniken für chirurgische Zahnheilkunde medizinischer Universitäten, in Forschungsinstituten für Zahnmedizin sowie in Kiefer- und Gesichtsabteilungen Forschungsinstituten für Traumatologie und Orthopädie angeboten.
Bei der Einlieferung der Opfer in die Aufnahmeabteilung eines Krankenhauses empfiehlt es sich, drei Sortiergruppen zu identifizieren (nach VI Lukyanenko):
Die erste Gruppe besteht aus Patienten, die dringende Maßnahmen und qualifizierte oder spezialisierte Versorgung im Umkleide- oder Operationssaal benötigen: Personen mit Gesichtsverletzungen und anhaltender Blutung unter Verbänden oder aus der Mundhöhle; Patienten mit Erstickungsanfällen oder instabiler äußerer Atmung, nach Tracheotomie mit dichter Tamponade der Mundhöhle und des Rachens sowie Patienten in bewusstlosem Zustand. Sie werden zunächst auf einer Trage in den Operations- oder Umkleideraum gebracht.
Die zweite Gruppe – diejenigen, die eine Klärung der Diagnose und Bestimmung des Schweregrads der Verletzung erfordern. Dazu gehören Verletzte mit kombinierten Verletzungen an Kiefer und Gesicht, HNO-Organen, Schädel, Sehorganen usw.
Die dritte Gruppe – diejenigen, die in der zweiten Priorität an die Abteilung überwiesen werden müssen. Diese Gruppe umfasst alle Opfer, die nicht in die ersten beiden Gruppen aufgenommen wurden.
Vor Beginn der chirurgischen Behandlung muss das Opfer klinisch und radiologisch untersucht werden. Anhand der erhaltenen Daten wird der Umfang des Eingriffs festgelegt.
Die chirurgische Behandlung sollte, unabhängig davon, ob sie frühzeitig, verzögert oder spät erfolgt, sofort und wenn möglich vollständig erfolgen und lokale plastische Operationen an Weichteilen und sogar eine Knochentransplantation des Unterkiefers umfassen.
Wie AA Skager und TM Lurye (1982) hervorheben, wird die Natur des regenerativen Blastems (osteogen, chondrogen, faserig, gemischt) durch die oxybiotische Aktivität der Gewebe in der Frakturzone bestimmt, wobei alle traumatischen und therapeutischen Faktoren vor allem über die lokale Blutversorgung die Geschwindigkeit und Qualität der reparativen Osteogenese beeinflussen. Als Folge einer Verletzung kommt es immer zu Durchblutungsstörungen lokaler (Wunde und Frakturbereich), regionaler (maxillofazialer Bereich) oder allgemeiner (traumatischer Schock) Natur. Lokale und regionale Durchblutungsstörungen sind gewöhnlich längeranhaltend, insbesondere wenn die Fragmente nicht immobilisiert sind und entzündliche Komplikationen auftreten. Infolgedessen wird die reparative Reaktion der Gewebe gestört.
Bei ausreichender Blutversorgung des beschädigten Bereichs und unter Bedingungen der Fragmentstabilität kommt es zur primären Bildung sog. angiogenen Knochengewebes. Unter weniger günstigen vaskulär-regenerativen Bedingungen, die vor allem bei fehlender Stabilität im Bereich der Fragmentverbindung entstehen, bildet sich Bindegewebe oder Knorpel, d. h. es kommt zu einer „reparativen Osteosynthese“, insbesondere wenn die Fragmente nicht rechtzeitig und richtig ausgerichtet werden. Dieser Verlauf der reparativen Regeneration erfordert mehr Geweberessourcen und Zeit. Er kann mit einer sekundären Knochenfusion der Fraktur enden, aber in diesem Fall bleibt vernarbendes Bindegewebe mit Herden chronischer Entzündung manchmal lange bestehen oder verbleibt für immer im Frakturbereich, was sich klinisch in Form einer Verschlimmerung einer traumatischen Osteomyelitis äußern kann.
Aus Sicht der Optimierung des vaskulär-regenerativen Komplexes ist die geschlossene Reposition und Fixierung von Gesichtsknochenfragmenten gegenüber der offenen Osteosynthese mit breiter Freilegung der Fragmentenden im Vorteil.
Daher bilden folgende Prinzipien die Grundlage der modernen Behandlung von Knochenbrüchen:
- vollkommen genauer Vergleich der Fragmente;
- Bringen der Fragmente entlang der gesamten Bruchfläche in eine Position engen Kontakts (Aneinanderschlagen);
- starke Fixierung der repositionierten Fragmente und ihrer Kontaktflächen, wodurch jede sichtbare Beweglichkeit zwischen ihnen während der gesamten für die vollständige Heilung der Fraktur erforderlichen Zeit eliminiert oder fast eliminiert wird;
- Erhalt der Beweglichkeit der Kiefergelenke, wenn der Chirurg über ein Gerät zur extraoralen Reposition und Fixierung von Unterkieferfragmenten verfügt.
Dies gewährleistet eine schnellere Fusion der Knochenfragmente. Die Einhaltung dieser Prinzipien gewährleistet eine primäre Fusion der Fraktur und ermöglicht kürzere Behandlungszeiten für die Patienten.
Zusätzliche allgemeine und lokale Behandlungsmaßnahmen bei frischen Frakturen mit Entzündungskomplikation
Die spezialisierte Behandlung von Kiefer- und Gesichtsverletzungen umfasst eine Reihe von Maßnahmen zur Vorbeugung von Komplikationen und zur Beschleunigung der Knochenregeneration (Physiotherapie, Bewegungstherapie, Vitamintherapie usw.). Alle Patienten sollten außerdem mit der notwendigen Ernährung und angemessener Mundpflege versorgt werden. In großen Abteilungen empfiehlt es sich, spezielle Stationen für Traumapatienten einzurichten.
Bei allen Hilfeleistungen ist eine verständliche und korrekte medizinische Dokumentation erforderlich.
Maßnahmen zur Vorbeugung von Komplikationen umfassen die Verabreichung von Antitetanusserum, die lokale Verabreichung von Antibiotika in der präoperativen Phase, die Hygiene der Mundhöhle und die vorübergehende Ruhigstellung von Fragmenten (soweit möglich). Es ist wichtig zu bedenken, dass Infektionen bei Frakturen innerhalb des Zahnbogens nicht nur bei einem Riss der Schleimhaut oder einer Schädigung der Haut auftreten können, sondern auch bei periapikalen Entzündungsherden von Zähnen im Frakturbereich oder in unmittelbarer Nähe.
Bei Bedarf erfolgt zusätzlich zur Anlage eines Standard-Transportverbandes eine intermaxilläre Fixierung mittels Ligaturenabbindung der Zähne.
Die Anästhesiemethode wird je nach Situation und Anzahl der aufgenommenen Patienten ausgewählt. Neben dem Allgemeinzustand des Patienten müssen Ort und Art der Fraktur sowie der voraussichtliche Zeitaufwand für die orthopädische Fixierung oder Osteosynthese berücksichtigt werden. In den meisten Fällen von Frakturen des Kieferkörpers und der Kieferäste (mit Ausnahme von hohen Frakturen des Gelenkfortsatzes, die mit einer Luxation des Unterkieferkopfes einhergehen) können lokale Leitungs- und Infiltrationsanästhesien angewendet werden. Eine Leitungsanästhesie wird am besten im Bereich der ovalen Öffnung durchgeführt (falls erforderlich auf beiden Seiten), um nicht nur die sensiblen, sondern auch die motorischen Äste des Nervus mandibularis abzuschalten. Eine verstärkte Lokalanästhesie ist wirksamer. Ein erweiterter Leitungsblock und seine Kombination mit der Verwendung von Calypsol in subnarkotischen Dosen werden ebenfalls angewendet.
Um zu entscheiden, was mit einem Zahn, der sich direkt im Frakturspalt befindet, zu tun ist, muss die Beziehung seiner Wurzeln zur Frakturebene bestimmt werden. Drei Positionen sind möglich:
- der Frakturspalt verläuft entlang der gesamten Seitenfläche der Zahnwurzel – vom Hals bis zur Öffnung der Spitze;
- die Zahnspitze befindet sich im Frakturspalt;
- Der Bruchspalt verläuft schräg zur Zahnhochachse, jedoch außerhalb des Zahnfachs, ohne den Zahnhalteapparat und die Wände des Zahnfachs zu beschädigen.
Die dritte Position des Zahns ist hinsichtlich der Konsolidierungsprognose am günstigsten (ohne Entwicklung einer klinisch erkennbaren entzündlichen Komplikation), und die erste Position ist die ungünstigste, da in diesem Fall ein Riss der Zahnfleischschleimhaut am Zahnhals und ein klaffender Frakturspalt auftreten, was zu einer unvermeidlichen Infektion der Kieferfragmente mit pathogener Mikroflora der Mundhöhle führt. Daher ist es bereits vor der Ruhigstellung notwendig, Zähne in der ersten Position sowie gebrochene, verrenkte, gequetschte, durch Karies zerstörte, durch Pulpitis oder chronische Parodontitis komplizierte Zähne zu entfernen. Nach der Zahnextraktion wird empfohlen, die Frakturzone durch Tamponieren der Alveole mit Jodoformgaze zu isolieren. NM Gordiyuk et al. (1990) empfehlen, die Alveolen mit konserviertem (in einer 2%igen Chloraminlösung) Amnion zu tamponieren.
Es ist sehr wichtig, die Beschaffenheit der Mikroflora im Frakturbereich zu bestimmen und ihre Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika zu untersuchen. Intakte Zähne in der zweiten und dritten Position können bedingt im Frakturspalt belassen werden. In diesem Fall sollte jedoch eine komplexe Behandlung mit Antibiotika und Physiotherapie erfolgen. Treten während einer solchen Behandlung erste klinische Entzündungszeichen im Frakturbereich auf, wird der verbleibende Zahn konservativ behandelt, seine Wurzelkanäle werden gefüllt und, falls vorhanden, entfernt.
Zahnrudimente, Zähne mit ungeformten Wurzeln und noch nicht durchgebrochene Zähne (insbesondere Weisheitszähne) können bei fehlender Entzündung um sie herum auch bedingt im Frakturbereich belassen werden, denn wie unsere Erfahrung und die Beobachtungen anderer Autoren zeigen, ist der Gesundheitszustand im Bereich der im Frakturspalt verbliebenen Zähne, klinisch festgestellt am Tag der Entlassung des Patienten aus dem Krankenhaus, oft trügerisch und instabil, insbesondere in den ersten 3–9 Monaten nach der Verletzung. Dies erklärt sich dadurch, dass manchmal die Pulpa von zweiwurzeligen Zähnen im Frakturbereich, begleitet von einer Schädigung des Unterkiefer-Gefäß-Nerven-Bündels, tiefe entzündlich-dystrophische Veränderungen erfährt, die in einer Nekrose enden. Wenn das Gefäß-Nerven-Bündel eines einwurzeligen Zahns geschädigt ist, werden in den meisten Fällen nekrotische Veränderungen in der Pulpa beobachtet.
Nach Angaben verschiedener Autoren ist der Erhalt der Zähne im Frakturspalt nur bei 46,3 % der Patienten möglich, da der Rest Parodontitis, Knochenresorption und Osteomyelitis entwickelt. Gleichzeitig weisen Zahnrudimente und Zähne mit unvollständig ausgebildeten Wurzeln, die erhalten bleiben, sofern keine Entzündungszeichen vorliegen, eine hohe Lebensfähigkeit auf: Nach zuverlässiger Ruhigstellung der Fragmente entwickeln sich die Zähne normal weiter (bei 97 %) und brechen rechtzeitig durch, und die elektrische Erregbarkeit ihrer Pulpa normalisiert sich langfristig. Im Frakturspalt replantierte Zähne sterben durchschnittlich bei der Hälfte der Patienten ab.
Wenn neben einer Schädigung des Kiefer- und Gesichtsbereichs eine Gehirnerschütterung oder eine Hirnverletzung, eine Funktionsstörung des Kreislaufsystems, der Atemwege und des Verdauungssystems usw. vorliegt, werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen und eine geeignete Behandlung verordnet. Oft ist es notwendig, Konsultationen mit verschiedenen Spezialisten durchzuführen.
Aufgrund der anatomischen Verbindung der Schädel- und Gesichtsknochen leiden bei einem Trauma im Kiefer- und Gesichtsbereich alle Strukturen des Schädels. Die Kraft des einwirkenden Faktors übersteigt in ihrer Intensität meist die Elastizitäts- und Festigkeitsgrenzen einzelner Gesichtsknochen. In solchen Fällen werden angrenzende und tiefer gelegene Gesichts- und sogar Schädelbereiche geschädigt.
Ein Merkmal kombinierter Gesichts- und Hirntraumata ist, dass Hirnschäden auch ohne einen Schlag auf den Hirnschädel auftreten können. Die traumatische Kraft, die eine Gesichtsknochenfraktur verursacht, wird direkt auf das angrenzende Gehirn übertragen und verursacht neurodynamische, pathophysiologische und strukturelle Veränderungen unterschiedlichen Ausmaßes. Daher können kombinierte Schäden im Kiefer- und Gesichtsbereich und im Gehirn durch die Einwirkung eines traumatischen Agens nur auf den Gesichtsschädel oder gleichzeitig auf den Gesichts- und Hirnschädel verursacht werden.
Klinisch manifestiert sich eine geschlossene Schädel-Hirn-Verletzung durch allgemeine zerebrale und lokale Symptome. Zu den allgemeinen zerebralen Symptomen zählen Bewusstlosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Amnesie. Zu den lokalen Symptomen zählen Funktionsstörungen der Hirnnerven. Alle Patienten mit einer Gehirnerschütterung in der Anamnese benötigen eine komplexe Behandlung durch einen Neurochirurgen oder Neurologen. Leider wird eine Gehirnerschütterung in Kombination mit einem Gesichtsknochentrauma meist nur bei ausgeprägten neurologischen Symptomen diagnostiziert.
Komplikationen von Kieferfrakturen, Prävention und Behandlung
Alle Komplikationen, die sich aus Kieferfrakturen ergeben, können in allgemeine und lokale, entzündliche und nicht-entzündliche Komplikationen unterteilt werden; zeitlich gesehen werden sie in frühe und späte Komplikationen unterteilt.
Zu den häufigsten Frühkomplikationen zählen Störungen des psychoemotionalen und neurologischen Zustands sowie Veränderungen des Kreislaufsystems und anderer Systeme. Die Prävention und Behandlung dieser Komplikationen erfolgt durch Kieferchirurgen in Zusammenarbeit mit entsprechenden Spezialisten.
Zu den am häufigsten beobachteten lokalen Frühkomplikationen zählen Funktionsstörungen des Kauapparates (einschließlich der Kiefergelenke), traumatische Osteomyelitis (bei 11,7 % der Betroffenen), Eiterung von Hämatomen, Lymphadenitis, Arthritis, Abszesse, Phlegmone, Sinusitis, verzögerte Fragmentkonsolidierung usw.
Um möglichen allgemeinen und lokalen Komplikationen vorzubeugen, empfiehlt es sich, eine Novocain-Blockade des Trigeminus-Sympathikus und der Karotissinus durchzuführen, die es ermöglicht, extrazerebrale reflexogene Zonen abzuschalten, wodurch die Dynamik der zerebrospinalen Flüssigkeit, die Atmung und die Hirndurchblutung normalisiert werden.
Die trigeminosympathische Blockade wird nach der bekannten Methode von MP Zhakov durchgeführt. Die Karotissinusblockade wird wie folgt durchgeführt: Dem auf dem Rücken liegenden Patienten wird auf Höhe der Schulterblätter ein Polster unter den Rücken gelegt, sodass der Kopf leicht nach hinten geneigt und in die entgegengesetzte Richtung gedreht wird. Eine Nadel wird entlang der Innenkante des Musculus sternocleidomastoideus, 1 cm unterhalb der Oberkante des Schildknorpels (Projektion des Karotissinus), injiziert. Beim Vordringen der Nadel wird Novocain injiziert. Beim Durchstechen der Faszie des Gefäß-Nerven-Bündels wird ein gewisser Widerstand überwunden und ein Pulsieren der Karotissinus spürbar. 15–20 ml 0,5%ige Novocainlösung werden injiziert.
Angesichts des erhöhten Risikos, septische Komplikationen bei Patienten mit Schäden im Kiefer- und Gesichtsbereich, im Gehirn und in anderen Körperregionen zu entwickeln, ist es notwendig, bereits am ersten Tag nach der Aufnahme ins Krankenhaus massive Antibiotikadosen (nach einem intradermalen Test auf individuelle Verträglichkeit) zu verschreiben.
Bei Komplikationen der Atemwege (die bei solchen Patienten häufig zum Tod führen) sind eine Hormontherapie und eine dynamische Röntgenbeobachtung (unter Einbeziehung entsprechender Spezialisten) angezeigt. Die spezialisierte Betreuung solcher Patienten durch einen Kieferchirurgen sollte unmittelbar nach der Schockerlösung, spätestens jedoch 24–36 Stunden nach der Verletzung erfolgen.
Verschiedene lokale und allgemeine negative Faktoren (Infektionen der Mundhöhle und kariöse Zähne, Quetschungen von Weichteilen, Hämatome, unzureichende Fixierung, Erschöpfung des Patienten aufgrund von Ernährungsstörungen, psycho-emotionaler Stress, Funktionsstörungen des Nervensystems usw.) tragen zur Entstehung von Entzündungsprozessen bei. Daher ist einer der Hauptpunkte der Behandlung des Betroffenen die Stimulierung des Heilungsprozesses der Kieferfraktur durch Steigerung der Regenerationsfähigkeit des Körpers des Patienten und die Vorbeugung von Entzündungsschichten im geschädigten Bereich.
In den letzten Jahren hat aufgrund der zunehmenden Resistenz von Staphylokokkeninfektionen gegen Antibiotika die Zahl entzündlicher Komplikationen bei Gesichtsknochenverletzungen zugenommen. Die meisten Komplikationen in Form von entzündlichen Prozessen treten bei Frakturen im Bereich des Unterkieferwinkels auf. Dies erklärt sich dadurch, dass sich die Kaumuskeln auf beiden Seiten des Frakturbereichs reflexartig zusammenziehen, in den Spalt eindringen und zwischen den Fragmenten eingeklemmt werden. Da die Zahnfleischschleimhaut im Bereich des Unterkieferwinkels fest mit dem Periost des Alveolarfortsatzes verwachsen ist und bei der geringsten Verschiebung der Fragmente reißt, bilden sich ständig klaffende Eintrittspforten für Infektionen, durch die pathogene Mikroorganismen, Speichel, abgeblätterte Epithelzellen und Speisereste in den Knochenspalt gelangen. Beim Schlucken ziehen sich die durch die Fragmente eingeklemmten Muskelfasern zusammen, wodurch ein aktiver Speichelfluss in die Tiefe des Knochenspalts stattfindet.
Hinweise auf eine zunehmende Entzündung des Knochens und der Weichteile sind meist eine sich rasch entwickelnde Hyperämie der Haut, Schmerzen, Infiltrationen etc.
Die Entwicklung von Komplikationen wird durch Faktoren wie Parodontitis (bei 14,4 % der Betroffenen), verzögerte Krankenhauseinweisung und vorzeitige Bereitstellung einer fachärztlichen Versorgung, hohes Alter der Patienten, das Vorhandensein chronischer Begleiterkrankungen, schlechte Gewohnheiten (Alkoholismus), verminderte Reaktionsfähigkeit des Körpers, falsche Diagnose und Wahl der Behandlungsmethode, Funktionsstörungen des peripheren Nervensystems infolge einer Fraktur (Schädigung der Äste des Trigeminusnervs) usw. begünstigt.
Ein wesentlicher Faktor, der die Konsolidierung von Kieferfragmenten verzögert, ist die traumatische Osteomyelitis, die neben anderen entzündlichen Prozessen besonders häufig in Fällen auftritt, in denen die Reposition und Ruhigstellung der Fragmente zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wurde.
Es muss berücksichtigt werden, dass jede Verletzung eine Entzündungsreaktion um die Wunde herum verursacht. Unabhängig von der Art des schädigenden Agens (physikalisch, chemisch, biologisch) sind die pathogenetischen Mechanismen des sich entwickelnden Entzündungsprozesses dieselben und zeichnen sich durch eine Verletzung des Mikrozirkulationszustands, Redoxprozesse und die Wirkung von Mikroorganismen im geschädigten Gewebe aus. Bei Verletzungen ist eine bakterielle Kontamination der Wunde unvermeidlich. Die Schwere des eitrig-entzündlichen Prozesses hängt von den Eigenschaften des Infektionserregers, dem immunbiologischen Zustand des Körpers des Patienten zum Zeitpunkt der Erregereinschleppung sowie dem Grad der Gefäß- und Stoffwechselstörungen des Gewebes an der Verletzungsstelle ab. Die Resistenz geschädigter Gewebe gegen eitrige Infektionen wird stark reduziert, es werden Bedingungen für die Vermehrung des Erregers und die Manifestation seiner pathogenen Eigenschaften geschaffen, die eine Entzündungsreaktion hervorrufen und das Gewebe zerstören.
Am Wirkort des schädigenden Faktors werden optimale Bedingungen für die Aktivierung proteolytischer Enzyme geschaffen, die von Mikroorganismen, betroffenen Geweben und Leukozyten freigesetzt werden, sowie für die Bildung entzündungsfördernder Mediatoren – Histamin, Serotonin, Kinine, Heparin, aktivierte Proteine usw., die die Mikrozirkulation, den transkapillären Austausch und die Blutgerinnung stören. Gewebeproteasen, Produkte mikrobieller Aktivität, tragen zur Störung von Redoxprozessen und zur Trennung der Gewebeatmung bei.
Die daraus resultierende Ansammlung unteroxidierter Produkte und die Entwicklung einer Gewebeazidose führen zu sekundären Störungen der Mikrohämodynamik an der Verletzungsstelle und zur Entwicklung eines lokalen Vitaminmangels.
Besonders schwerwiegende Schäden an den Regenerationsprozessen des Gewebes werden beobachtet, wenn in ihnen ein Vitamin C-Mangel auftritt, der zu einer Hemmung der Kollagensynthese des Bindegewebes und der Wundheilung führt; in diesem Fall ist der Vitamin C-Gehalt in den schlaffen Granulationen infizierter Wunden deutlich reduziert.
Bei jeder Verletzung kommt der hämostatischen Reaktion eine wichtige Rolle bei der Begrenzung des Entzündungsprozesses zu, da die Bildung einer Fibrinschicht und die Ablagerung toxischer Substanzen und Mikroorganismen auf ihrer Oberfläche die weitere Ausbreitung des pathologischen Prozesses verhindert.
Bei eitrigen Komplikationen von Verletzungen entsteht somit eine geschlossene Kette pathologischer Prozesse, die die Ausbreitung von Infektionen fördern und die Wundheilung verhindern. Daher ist der frühzeitige Einsatz verschiedener biologisch aktiver Medikamente mit entzündungshemmender, antimikrobieller, antihypoxischer und reparativer Prozessstimulierung pathogenetisch gerechtfertigt, um eitrige Komplikationen zu reduzieren und die Wirksamkeit komplexer Behandlungen zu erhöhen.
Das Kiewer Forschungsinstitut für Orthopädie des Gesundheitsministeriums der Ukraine hat den Wirkungsmechanismus biologisch aktiver Substanzen untersucht und Amben, Galascorbin, Kalanchoe und Propolis zur Anwendung bei eitrig-entzündlichen Erkrankungen empfohlen.
Im Gegensatz zu natürlichen Proteolysehemmern (Trasylol, Contrycal, Iniprol, Tsalol, Gordox, Pantrypin) durchdringt Amben leicht alle Zellmembranen und kann lokal als 1%ige Lösung, intravenös oder intramuskulär in Dosen von 250–500 mg alle 6–8 Stunden angewendet werden. Innerhalb von 24 Stunden wird das Arzneimittel unverändert über die Nieren ausgeschieden. Bei lokaler Anwendung dringt es gut in das Gewebe ein und neutralisiert die Gewebefibrinolyse geschädigter Gewebe innerhalb von 10–15 Minuten vollständig.
Bei eitrig-entzündlichen Komplikationen von Kieferfrakturen wird Amoxiclav erfolgreich eingesetzt - eine Kombination von Clavulansäure mit Amoxicillin, die alle 8 Stunden intravenös mit 1,2 g oder 5 Tage lang dreimal täglich mit 375 mg oral verabreicht wird. Bei Patienten, die sich einer elektiven Operation unterzogen haben, wird das Medikament einmal täglich mit 1,2 g intravenös oder in der gleichen Dosierung oral verschrieben.
Die biologische Aktivität von Galascorbin übertrifft die Aktivität von Ascorbinsäure deutlich, da das Präparat Ascorbinsäure in Kombination mit Substanzen mit P-Vitamin-Aktivität (Polyphenole) enthält. Galascorbin fördert die Ansammlung von Ascorbinsäure in Organen und Geweben, verdickt die Gefäßwand, stimuliert Wundheilungsprozesse, beschleunigt die Regeneration von Muskel- und Knochengewebe und normalisiert Redoxprozesse. Galascorbin wird oral 4-mal täglich 1 g angewendet; lokal - in 1-5% frisch zubereiteten Lösungen oder in Form einer 5-10%igen Salbe.
Propolis enthält 50–55 % Pflanzenharze, 30 % Wachs und 10–18 % ätherische Öle; es wird in verschiedenen Balsamen verwendet und enthält Zimtsäure und Alkohol sowie Gerbstoffe. Es ist reich an Spurenelementen (Kupfer, Eisen, Mangan, Zink, Kobalt usw.), Antibiotika und Vitaminen der Gruppen B, E, C, PP, P und Provitamin A und hat eine schmerzstillende Wirkung. Seine antibakterielle Wirkung ist am ausgeprägtesten. Die antimikrobiellen Eigenschaften von Propolis wurden in Bezug auf eine Reihe pathogener grampositiver und gramnegativer Mikroorganismen festgestellt, und seine Fähigkeit, die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegenüber Antibiotika zu erhöhen sowie die morphologischen, kulturellen und färberischen Eigenschaften verschiedener Stämme zu verändern, wurde beobachtet. Unter dem Einfluss von Propolis werden Wunden schnell von eitrigem und nekrotischem Belag befreit. Es wird in Form einer Salbe (33 g Propolis und 67 g Lanolin) oder sublingual – in Form von Tabletten (0,01 g) 3-mal täglich angewendet.
Um entzündlichen Komplikationen vorzubeugen und die Osteogenese zu stimulieren, werden auch andere Maßnahmen empfohlen. Einige davon sind unten aufgeführt:
- Verabreichung von Antibiotika (unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit der Mikroflora) in die Weichteile rund um den offenen Frakturbereich ab dem ersten Behandlungstag. Die lokale Gabe von Antibiotika reduziert die Anzahl der Komplikationen um mehr als das Fünffache. Bei einer späteren Antibiotikagabe (am 6.-9. Tag und später) verringert sich die Anzahl der Komplikationen nicht, aber die Beseitigung der bereits entwickelten Entzündung wird beschleunigt.
- Intramuskuläre Gabe von Antibiotika bei entsprechender Indikation (Infiltratzunahme, erhöhte Körpertemperatur etc.).
- Lokale UHF-Therapie vom 2. bis zum 12. Tag ab dem Zeitpunkt der Verletzung (10-12 Minuten täglich), allgemeine Quarzbestrahlung vom 2.-3. Tag (ca. 20 Behandlungen), Calciumchlorid-Elektrophorese im Frakturbereich – vom 13.-14. Tag bis zum Ende der Behandlung (bis zu 15-20 Behandlungen).
- Besonders nützlich ist die orale Verabreichung von Multivitaminen und einer 5%igen Calciumchloridlösung (dreimal täglich ein Esslöffel mit Milch); Ascorbinsäure und Thiamin sind dabei besonders nützlich.
- Um die Konsolidierung der Fragmente zu beschleunigen, empfiehlt OD Nemsadze (1991) die zusätzliche Einnahme folgender Medikamente: Anabolika (z. B. Nerobol per os, 1 Tablette 3-mal täglich für 1–2 Monate oder Retabolil 50 mg intramuskulär einmal wöchentlich für 1 Monat); 1%ige Natriumfluoridlösung, 10 Tropfen 3-mal täglich für 2–3 Monate; Proteinhydrolysat (Hydrolysin, Caseinhydrolysat) für 10–20 Tage.
- Um den Krampf der Blutgefäße in der Frakturzone zu reduzieren (der laut AI Elyashev (1939) 1–1,5 Monate anhält und die Knochenbildung hemmt) und um die Konsolidierung der Fragmente zu beschleunigen, schlägt OD Nemsadze (1985) die intramuskuläre Verabreichung von krampflösenden Medikamenten (Gangleron, Dibazol, Papaverin, Trental usw.) 3 Tage nach der Verletzung für 10–30 Tage vor.
- Intramuskuläre Verabreichung von 100–150 mg Lysozym zweimal täglich für 5–7 Tage.
- Verwendung eines Komplexes aus Antioxidantien (Tocopherolacetat, Flacumin, Ascorbinsäure, Cystein, Eleutherococcus-Extrakt oder Acemin).
- Die Anwendung lokaler Hypothermie gemäß der von AS Komok (1991) beschriebenen Technik, vorausgesetzt, dass ein spezielles Gerät zur lokalen Hypothermie im Kiefer- und Gesichtsbereich verwendet wird, ermöglicht die Aufrechterhaltung des Temperaturregimes des verletzten Gewebes, einschließlich des Unterkieferknochens, im Bereich von +30 °C – +28 °C. Durch ausgewogene Gewebekühlung mithilfe der externen und intraoralen Kammern kann die Temperatur des zirkulierenden Kühlmittels auf +16 °C gesenkt werden, wodurch der Vorgang gut verträglich ist und lange fortgesetzt werden kann. AS Komok weist darauf hin, dass die Senkung der lokalen Gewebetemperatur in der Frakturzone des Unterkiefers auf folgende Werte: auf der Haut +28 °C, auf der Wangenschleimhaut +29 °C und auf der Schleimhaut des Alveolarfortsatzes des Unterkiefers +29,5 °C – hilft, den Blutfluss zu normalisieren, Venenstauungen und Schwellungen zu beseitigen, der Entstehung von Blutungen und Hämatomen vorzubeugen und Schmerzreaktionen zu beseitigen. Eine geschichtete, gleichmäßige, moderate Hypothermie des Gewebes im Kühlmodus von +30 °C – +28 °C während der nächsten 10–12 Stunden nach der Ruhigstellung des beidseitigen Kiefers ermöglicht in Kombination mit Medikamenten eine Normalisierung der Durchblutung des Gewebes bis zum dritten Tag, die Beseitigung von Temperaturreaktionen und Entzündungserscheinungen und bewirkt eine ausgeprägte schmerzstillende Wirkung.
Gleichzeitig betont AS Komok auch die Komplexität dieser Methode, da seinen Daten zufolge nur ein Komplex elektrophysiologischer Methoden, darunter Elektrothermometrie, Rheographie, Rheodermatometrie und Elektroalgesimetrie, eine ziemlich objektive Beurteilung des Blutflusses, des Wärmeaustauschs und der Innervation in verletzten Geweben sowie der Dynamik der Veränderungen dieser Indikatoren unter dem Einfluss der Behandlung ermöglicht.
Laut VP Korobov et al. (1989) kann die Korrektur von Stoffwechselverschiebungen im Blut bei Unterkieferfrakturen entweder durch Ferramid oder (noch wirksamer) durch Coamid erreicht werden, das die beschleunigte Fusion von Knochenfragmenten fördert. Bei akuter traumatischer Osteomyelitis wird der Abszess geöffnet und der Frakturspalt gespült; wünschenswert ist auch eine fraktionierte Eigenbluttherapie - Reinfusion von 3-5 mal mit ultravioletten Strahlen bestrahltem Blut zusammen mit einer aktiven entzündungshemmenden antiseptischen Therapie nach dem allgemein anerkannten Schema; Im Stadium einer chronischen Entzündung wird empfohlen, die Knochenregeneration nach folgendem Schema zu aktivieren: Levamisol (150 mg oral einmal täglich über 3 Tage; eine Pause zwischen den Zyklen beträgt 3-4 Tage; es gibt 3 solcher Zyklen) oder T-Activin subkutan (0,01 %, 1 ml über 5 Tage) oder Bestrahlung biologisch aktiver Punkte im Gesicht und am Hals mit einem Helium-Neon-Laser (10-15 s pro Punkt mit einer Lichtflussleistung von nicht mehr als 4 mW über 10 Tage). Nach Einsetzen der Steifheit im Frakturbereich wurden eine dosierte Mechanotherapie und andere allgemeine biologische Effekte verordnet. Den Autoren zufolge verkürzt sich die Dauer der stationären Behandlung um 10-12 Tage und die vorübergehende Behinderung um 7-8 Tage.
Zur Vorbeugung oder Behandlung einer traumatischen Kieferosteomyelitis wurden zahlreiche weitere Mittel und Methoden vorgeschlagen, beispielsweise eine Suspension aus demineralisiertem Knochen, Nitazol-Aerosol, Staphylokokken-Anatoxin mit Eigenblut, Vakuumaspiration des Frakturspaltinhalts und Spülen der Knochenwunde unter Druck mit einem Strahl einer 1%igen Dioxidinlösung; immunkorrektive Therapie. EA Karasyunok (1992) berichtet, dass er und seine Mitarbeiter vor dem Hintergrund einer rationalen Antibiotikatherapie die Angemessenheit der oralen Verabreichung einer 25%igen Aceminlösung (20 ml 2-mal täglich über 10–14 Tage) experimentell untersucht und klinisch nachgewiesen haben, ebenso wie die Sondierung des Frakturbereichs mit dem Gerät UPSK-7N im kontinuierlichen labilen Modus und die Einführung einer 10%igen Lincomycinhydrochloridlösung durch Elektrophorese. Durch den Einsatz dieser Technik konnten die Komplikationen von 28 % auf 3,85 % reduziert und die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit um 10,4 Tage verkürzt werden.
R. 3. Ogonovsky, IM Got, OM Sirii, I. Ya. Lomnitsky (1997) empfehlen die zelluläre Xeno-Brephotransplantation zur Behandlung langfristig nicht heilender Kieferfrakturen. Dazu wird eine Suspension devitalisierter Knochenmarkzellen von 14 Tage alten Embryonen in den Frakturspalt eingebracht. Am 12.–14. Tag beobachteten die Autoren eine Verdickung des periostalen Knochenkallus und am 20.–22. Tag den Beginn einer stabilen Konsolidierung der Fraktur, die während 60 Tagen Ruhigstellung nicht verheilt war. Diese Methode ermöglicht es, wiederholte chirurgische Eingriffe zu vermeiden.
In der in- und ausländischen Literatur gibt es zahlreiche weitere Vorschläge, die derzeit leider nur Ärzten in Kliniken zur Verfügung stehen, die mit der erforderlichen Ausrüstung und den erforderlichen Medikamenten gut ausgestattet sind. Jeder Arzt sollte jedoch bedenken, dass es andere, leichter zugängliche Mittel zur Vorbeugung von Komplikationen bei der Behandlung von Gesichtsknochenfrakturen gibt. Man sollte beispielsweise nicht vergessen, dass ein so einfaches Verfahren wie die Calciumchlorid-Elektrophorese (Einleitung einer 40%igen Lösung von der Anode bei einer Stromstärke von 3 bis 4 mA) die schnelle Verdichtung des sich bildenden Knochenkallus fördert. Im Falle einer Frakturkomplikation durch eine Entzündung ist zusätzlich zur Antibiotikatherapie eine Alkohol-Novocain-Blockade (0,5%ige Novocain-Lösung in 5%igem Alkohol) ratsam. Eine komplexe Behandlung nach dem beschriebenen Schema ermöglicht es, die Zeit der Fragmentimmobilisierung um 8–10 Tage zu verkürzen, bei Frakturen, die durch den Entzündungsprozess kompliziert sind, um 6–8 Tage.
Wir beobachteten eine signifikante Verkürzung der Krankenhausaufenthaltsdauer, wenn 0,2 ml osteogenen zytotoxischen Serums (Stimoblasten) in isotonischer Natriumchloridlösung (Verdünnung 1:3) in den Frakturbereich eingebracht wurden. Das Serum wurde am 3., 7. und 11. Tag nach der Verletzung verabreicht.
Einige Autoren empfehlen, Mikrowellen- und UHF-Therapie in Kombination mit allgemeiner Ultraviolettbestrahlung und Calciumchlorid-Elektrophorese in eine komplexe Behandlung einzubeziehen, um die Konsolidierung von Kieferfragmenten zu beschleunigen, und VP Pyurik (1993) empfiehlt die Verwendung einer Interfragment-Injektion von Knochenmarkszellen des Patienten (mit einer Rate von 1 mm3 Zellen pro 1 cm2 Knochenbruchoberfläche ).
Aufgrund des Entstehungsmechanismus entzündlicher Komplikationen bei Frakturen im Bereich der Unterkieferwinkel erfordert deren Vorbeugung die frühestmögliche Ruhigstellung der Knochenfragmente in Kombination mit einer gezielten entzündungshemmenden medikamentösen Therapie. Insbesondere sollte nach der Behandlung der Mundhöhle mit Furacilinlösung (1:5000) eine Infiltrationsanästhesie im Frakturbereich mit einer 1%igen Novocainlösung (von der Hautseite) durchgeführt werden. Nachdem sichergestellt wurde, dass sich die Nadel im Frakturspalt befindet (Blut gelangt in die Spritze und das Anästhetikum in den Mund), sollte der Inhalt des Spalts wiederholt (mit Furacilinlösung) durch die beschädigte Schleimhaut in die Mundhöhle gespült werden (LM Vartanyan).
Vor der Ruhigstellung der Kieferfragmente mittels starrer intermaxillärer Fixierung (Traktion) oder der schonendsten (perkutanen) Osteosynthesemethode mit Kirschnerdraht empfiehlt es sich, die Weichteile im Bereich der Unterkieferwinkelfraktur mit einer Breitband-Antibiotikalösung zu infiltrieren. Stärkere Traumata (z. B. Freilegung des Kieferwinkels und Anlegen einer Knochennaht) sind unerwünscht, da sie zur Verschärfung des begonnenen Entzündungsprozesses beitragen.
Bei einer entwickelten traumatischen Osteomyelitis kann die Fraktur nach einer Sequestrektomie mit einem transfokal (durch den Frakturspalt) eingeführten Metallstift fixiert werden. Effektiver ist jedoch die Fixierung der Unterkieferfragmente mit externen extrafokalen Kompressionsvorrichtungen, die bei Frakturen mit einer traumatischen Osteomyelitis-Komplikation (im akuten Verlaufsstadium) eine Konsolidierung innerhalb des üblichen Zeitrahmens (nicht über die Heilung frischer Frakturen hinaus) gewährleisten und den Entzündungsprozess stoppen, da die Kompression ohne vorherigen Eingriff in die Läsion erfolgt. Die extrafokale Fixierung der Fragmente ermöglicht zukünftige notwendige chirurgische Eingriffe (Eröffnung eines Abszesses, einer Phlegmone, Entfernung von Sequestern usw.), ohne die Immobilisierung zu verletzen.
Eine traumatische Osteomyelitis verläuft fast immer träge und beeinträchtigt den Allgemeinzustand des Patienten nicht signifikant. Eine langfristige Schwellung der Weichteile im Frakturbereich ist mit Stauung, Periostreaktion und Lymphknoteninfiltration verbunden. Die Abstoßung von Knochensequestern aus dem Frakturspalt erfolgt langsam; ihre Größe ist meist unbedeutend (wenige Millimeter). Periodisch sind Exazerbationen von Osteomyelitis, Periostitis und Lymphadenitis mit der Bildung von perimandibulären Abszessen, Phlegmonen und Adenophlegmonen möglich. In diesen Fällen ist eine Gewebepräparation zur Eiterabsaugung, Wunddrainage und die Gabe von Antibiotika erforderlich.
Im chronischen Stadium einer Osteomyelitis ist eine Kompressionsrekonstruktion der Kieferfragmente ratsam, oder man verschreibt 10-14 Tage lang dreimal täglich 0,2–0,3 g Pentoxyl (sowohl nach der Schienung als auch nach der perkutanen Osteosynthese) oder injiziert (mit einer Dufour-Nadel) 2–3 ml einer Suspension aus lyophilisiertem fötalem Allobone-Pulver in den Frakturspalt. Es wird empfohlen, die Suspension einmal unter örtlicher Betäubung 2–3 Tage nach der Reposition und Fixierung der Fragmente zu injizieren, d. h. wenn die verheilte Wunde am Zahnfleisch ein Austreten der Suspension in die Mundhöhle verhindert. Dank dieser Taktik kann die intermaxilläre Traktion sowohl bei Einzel- als auch bei Doppelfrakturen 6–7 Tage früher als üblich entfernt werden, wodurch die Gesamtdauer der Behinderung um durchschnittlich 7–8 Tage verkürzt wird. Die extraorale Injektion von 5–10 ml einer 10%igen Alkohollösung in 0,5%iger Novocainlösung in den Frakturbereich beschleunigt die klinische Konsolidierung der Fragmente um 5–6 Tage und verkürzt die Dauer der Behinderung um durchschnittlich 6 Tage. Die Verwendung von Allocosteum und Pentoxyl ermöglicht eine signifikante Reduzierung der Anzahl entzündlicher Komplikationen.
Es liegen Daten zur Wirksamkeit verschiedener anderer Methoden und Mittel zur Stimulierung der Osteogenese (im Bereich der traumatischen Osteomyelitis) vor: fokal dosiertes Vakuum, Ultraschallbestrahlung, Magnetfeldtherapie nach NA Berezovskaya (1985), elektrische Stimulation; schwache Bestrahlung mit einem Helium-Neon-Laser unter Berücksichtigung des Stadiums des posttraumatischen Prozesses; lokale Sauerstofftherapie und drei-, vierfache Röntgenbestrahlung in Dosen von 0,3-0,4 fe (bei ausgeprägten Anzeichen einer akuten Entzündung, wenn Schwellungen und Infiltrationen gelindert oder die Abszessbildung beschleunigt, Schmerzsymptome gelindert und günstige Bedingungen für die Wundheilung geschaffen werden müssen); Thyrocalcitonin, Ekterizid in Kombination mit Ascorbinsäure, Nerobol in Kombination mit Proteinhydrolysat, Phosphren, Gemostimulin, Fluoridpräparate, osteogenes zytotoxisches Serum, Carbostimulin, Retabolil, Eleutherococcus; Aufnahme von "Ocean"-Paste aus Krill usw. in die Ernährung des Patienten. Im Stadium der chronischen traumatischen Osteomyelitis nach Nekrektomie verwenden einige Autoren eine Strahlentherapie mit einer Dosis von 0,5–0,7 Gray (5–7 Bestrahlungen), um lokale Anzeichen einer Verschlimmerung des Entzündungsprozesses zu beseitigen, die Wundreinigung von nekrotischen Massen zu beschleunigen und Schlaf, Appetit und allgemeines Wohlbefinden der Patienten zu verbessern. Gute Ergebnisse bei traumatischer Osteomyelitis des Unterkiefers werden erzielt, wenn eine Sequestrektomie mit einer radikalen Behandlung der Knochenwunde kombiniert wird, der Knochendefekt mit Brefobone gefüllt und die Kieferfragmente starr immobilisiert werden.
Bei einer Fraktur in Kombination mit einer Parodontitis sind Entzündungen im Weichgewebe des Frakturbereichs besonders ausgeprägt. Patienten, die am 3.–4. Tag aufgenommen werden, weisen ausgeprägte Zahnfleischentzündungen, Zahnfleischbluten, Mundgeruch und Eiterausfluss aus pathologischen Taschen auf. Die Frakturkonsolidierung bei Parodontitis dauert länger. In solchen Fällen empfiehlt sich eine komplexe Parodontitisbehandlung parallel zur Frakturbehandlung.
Physiotherapie ist bei der Behandlung von Unterkieferfrakturen von großer Bedeutung. Aktive Übungen für die Kaumuskulatur (mit minimalem Bewegungsumfang), die Gesichtsmuskulatur und die Zunge können 1–2 Tage nach der Ruhigstellung mit einer Einzelkieferschiene oder einer extraoralen Knochenschiene begonnen werden. Mit intermaxillärer Traktion können ab dem 2.–3. Tag nach der Fraktur (Schienung) bis zur Entfernung der Gummitraktion allgemeine tonische Übungen, Übungen für die Gesichtsmuskulatur und die Zunge sowie Übungen zur willkürlichen Anspannung der Kaumuskulatur durchgeführt werden. Nach der primären Frakturkonsolidierung und Entfernung der intermaxillären Gummitraktion werden aktive Übungen für den Unterkiefer verordnet.
Eine Durchblutungsstörung im Bereich der Kaumuskulatur führt zu einer verminderten Intensität der Mineralisierung des Regenerats im Winkelbruchspalt (VI Vlasova, IA Lukyanchikova), was auch häufige entzündliche Komplikationen verursacht. Rechtzeitig verordnetes körperliches Aktivitätsprogramm (therapeutische Übungen) verbessert die elektromyografischen, gnathodynometrischen und dynamometrischen Indizes der Kaumuskulaturfunktion erheblich. Eine frühzeitige funktionelle Belastung der Alveolarfortsätze mit Zahnfleischschienen-Prothesen bei Frakturen innerhalb des Zahnbogens (bei einem zahnlosen Fragment, das manuell reponiert und von der Basis der Schienen-Prothese gehalten werden kann, sowie bei starr stabiler Ruhigstellung mittels Osteosynthese) trägt ebenfalls dazu bei, die Arbeitsunfähigkeitsdauer um durchschnittlich 4–5 Tage zu verkürzen. Durch die Einbeziehung funktioneller Kaubelastungen in den Therapiekomplex wird das Regenerat schneller umstrukturiert, seine histologische Struktur und Funktion wiederhergestellt und gleichzeitig seine anatomische Form beibehalten.
Um das Ausmaß hypodynamischer Störungen der Kaumuskulatur und im Bereich der Unterkieferfraktur zu reduzieren, kann die in der allgemeinen Traumatologie, Sport- und Weltraummedizin übliche bioelektrische Stimulation der Temporoparietal- und Kaumuskulatur mit dem Gerät Myoton-2 angewendet werden. Die Prozeduren werden 15–20 Tage lang täglich 5–7 Minuten lang durchgeführt, beginnend am 1.–3. Tag nach der Ruhigstellung. Die elektrische Stimulation führt zur Kontraktion der angegebenen Muskeln, ohne dass Bewegungen in den Kiefergelenken auftreten. Dadurch werden die Durchblutung und die neuroreflexiven Verbindungen im Kiefer- und Gesichtsbereich schneller wiederhergestellt und der Muskeltonus erhalten. All dies trägt auch dazu bei, die Frakturkonsolidierung zu verkürzen.
Laut VI Chirkin (1991) ermöglichte die Einbeziehung einer mehrkanaligen biokontrollierten proportionalen elektrischen Stimulation der Schläfen-, Kau- und Senkmuskeln des Unterkiefers in den üblichen Komplex subschwelliger und therapeutischer Rehabilitationsmaßnahmen bei Patienten mit einseitigem Trauma, bis zum 28. Tag die vollständige Wiederherstellung der Blutversorgung des Gewebes, eine Erhöhung des Mundöffnungsvolumens auf 84 % und der Amplitude der M-Reaktion auf 74 % im Vergleich zur Norm. Die Kaufunktion konnte normalisiert werden, und die Patienten verbrachten mit dem Kauen von Nahrungsproben genauso viel Zeit und machten genauso viele Kaubewegungen wie gesunde Personen.
Bei Patienten mit beidseitigem Operationstrauma der Kaumuskulatur kann bereits in einem frühen Stadium (7–9 Tage nach der Operation) mit Verfahren der mehrkanaligen biokontrollierten proportionalen elektrischen Stimulation im unterschwelligen Therapie- und Trainingsmodus begonnen werden. Dies gewährleistet positive Veränderungen der Blutversorgung des Verletzungsbereichs, wie die Ergebnisse rheographischer Untersuchungen belegen, die zum Zeitpunkt der Schienenentfernung den Normalwert erreichten.
Das Mundöffnungsvolumen konnte auf 74 % gesteigert werden, die Amplitude der M-Reaktion stieg ebenfalls auf 68 %. Die Kaufunktion normalisierte sich laut funktioneller Elektromyographie nahezu, deren Werte das Niveau der durchschnittlichen Werte gesunder Personen erreichten. Der Autor ist der Ansicht, dass die Methode der Mehrkanal-Rheovasofaziographie, die Stimulationselektromyographie der Kaumuskulatur, die Registrierung des parodontomuskulären Reflexes und die Methode der Mehrkanal-funktionellen Elektromyographie mit Standard-Lebensmittelproben die objektivsten Methoden zur Untersuchung des Kausystems sind und die Methoden der Wahl bei der Untersuchung von Patienten sowohl mit Kieferfrakturen als auch mit chirurgischen (operativen) Traumata der Kaumuskulatur sein können.
Verfahren der mehrkanaligen biokontrollierten proportionalen elektrischen Stimulation der Kaumuskulatur in drei Modi gemäß der vom Autor empfohlenen Methode ermöglichen einen frühzeitigen Beginn der funktionellen Rehabilitationsbehandlung. Diese Behandlungsart entspricht am besten der natürlichen Funktion des Kausystems, ist gut dosiert und kontrolliert, führt zu den bisher besten Ergebnissen bei der Funktionswiederherstellung und ermöglicht eine Verkürzung der Gesamtarbeitsunfähigkeit der Patienten um 5–10 Tage.
Das Problem der Behandlung und Rehabilitation von Patienten mit Unterkieferfrakturen, die mit einer Schädigung des Nervus alveolaris inferior einhergehen, verdient besondere Beachtung. Laut SN Fedotov (1993) wurde bei 82,2 % der Opfer einer Unterkieferfraktur eine Schädigung des Nervus alveolaris inferior diagnostiziert, davon 28,3 % leichte, 22 % mittelschwere und 31,2 % schwere Verletzungen. Zu den leichten Verletzungen zählen solche, bei denen die Reaktion aller Zähne auf der Frakturseite innerhalb von 40–50 μA lag und eine leichte Hypästhesie im Bereich der Kinnhaut und der Mundschleimhaut beobachtet wurde; zur mittelschweren Kategorie gehört eine Reaktion der Zähne bis zu 100 μA. Bei einer Reaktion über 100 μA und einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Weichteilsensibilität wird der Schaden als schwerwiegend angesehen. Gleichzeitig haben neurologische Störungen bei Gesichtsknochenfrakturen und ihre Behandlung in der praktischen Medizin bisher nicht genügend Aufmerksamkeit erhalten. Laut SN Fedorov nimmt die Tiefe der Nervenschädigung bei chirurgischen Methoden zur Fragmentverbindung noch weiter zu. Infolgedessen entwickeln sich langfristige sensorische Störungen, neurotrophe Zerstörungsprozesse im Knochengewebe, eine Verlangsamung der Fragmentfusion, eine verminderte Kaufunktion und unerträgliche Schmerzen.
Basierend auf seinen klinischen Beobachtungen (336 Patienten) entwickelte der Autor einen rationalen Komplex zur restaurativen Behandlung von Unterkieferfrakturen mit Schädigung des dritten Trigeminusastes unter Verwendung physikalischer Methoden und medikamentöser Stimulanzien (Neurotropika und Vasodilatatoren). Um Sekundärschäden am Nervus alveolaris inferior und seinen Ästen während der chirurgischen Behandlung von Frakturen zu verhindern, wird eine neue Variante der Osteosynthese von Fragmenten mit Metallspeichen vorgeschlagen, die auf einer schonenden Behandlung der Zähne sowie der Äste des Nervus alveolaris inferior basiert.
Bei einigen Patienten mit neurologischen Störungen verordnete der Autor bereits am 2.-3. Tag nach der Ruhigstellung der Fragmente eine Exposition gegenüber einem UHF-Elektrofeld oder einer Sollux-Lampe; bei Schmerzen entlang des Nervus alveolaris inferior kam eine Elektrophorese einer 0,5%igen Novocainlösung mit Adrenalin nach AP Parfenov (1973) zum Einsatz. Anderen Patienten wurde je nach Indikation nur Ultraschall verschrieben. Nach 12 Tagen, im Stadium der Bildung des primären Knochenkallus, wurde eine Elektrophorese mit einer 5%igen Calciumchloridlösung verordnet.
Gleichzeitig mit der physikalischen Behandlung wurden ab dem 2.-3. Tag auch medizinische Stimulanzien verwendet: Vitamin B6 B12; Dibazol in einer Dosierung von 0,005; bei schweren Erkrankungen 1 ml einer 0,05%igen Proserinlösung gemäß Schema. Gleichzeitig wurden Medikamente zur Anregung der Durchblutung verschrieben (Papaverinhydrochlorid 2 ml einer 2%igen Lösung; Nicotinsäure 1 % 1 ml; Complamin 2 ml einer 15%igen Lösung für eine Kur mit 25-30 Injektionen).
Nach einer Pause von 7–10 Tagen wurde bei anhaltenden Nervenschäden eine Elektrophorese mit 10 %iger Kaliumiodlösung oder eine Elektrophorese mit Enzymen über einen Kurs von 10–12 Eingriffen verordnet; 1 ml 1 % Galantamin wurde für einen Kurs von 10–20 Injektionen, Paraffin- und Ozokerit-Anwendungen verwendet. Nach 3–6 Monaten wurden die Behandlungszyklen bis zur vollständigen Genesung wiederholt, wenn die neurologischen Störungen anhielten. Ein obligatorischer Bestandteil der von SN Fedotov empfohlenen Behandlung ist die ständige Überwachung ihrer Wirksamkeit anhand neurologischer Forschungsmethoden. Die Anwendung des beschriebenen Komplexes der restaurativen Behandlung trug zu einer schnelleren Wiederherstellung der Leitfähigkeit des Nervus alveolaris inferior bei: bei leichten Funktionsstörungen – innerhalb von 1,5–3 Monaten, bei mittelschweren und schweren – innerhalb von 6 Monaten. In der Gruppe der Patienten, die mit traditionellen Methoden behandelt wurden, war die Leitfähigkeit des Nervus alveolaris inferior bei leichten Störungen innerhalb von 1,5–3–6 Monaten wiederhergestellt, bei mittelschweren und schweren Störungen – innerhalb von 6–12 Monaten. Laut SN Fedorov litten etwa 20 % der Patienten seit über einem Jahr an anhaltenden und starken Störungen der Schmerzempfindlichkeit. Mäßige und schwere Verletzungen des Nervus alveolaris inferior gehen am wahrscheinlichsten mit einer Überdehnung des Nervenstamms zum Zeitpunkt der Fragmentverschiebung, Prellungen mit Nervenfaserbrüchen sowie teilweisen oder vollständigen Rupturen einher. All dies verlangsamt die Reinnervation. Eine frühere Wiederherstellung der trophischen Funktion des Nervensystems wirkte sich günstig auf die Qualität und den Zeitpunkt der Fragmentkonsolidierung aus. In der ersten (Haupt-)Patientengruppe trat die Fragmentkonsolidierung im Durchschnitt nach 27 ± 0,58 Tagen auf, die Arbeitsunfähigkeit betrug 25 ± 4,11 Tage. Die Kaufunktion und die Muskelkontraktilität erreichten nach 1,5–3 Monaten normale Werte. In der zweiten (Kontroll-)Gruppe betrugen diese Werte 37,7 ± 0,97 bzw. 34 ± 5,6 Tage, und die Kaufunktion und Muskelkontraktilität wurden später – nach 3–6 Monaten – wiederhergestellt. Die genannten Maßnahmen zur Weiterbehandlung von Traumapatienten sollten in Reha-Räumen durchgeführt werden.
Neben traumatischer Osteomyelitis, Abszessen und Phlegmonen bei Kieferfrakturen kann vor dem Hintergrund einer trägen Knochenentzündung eine submandibuläre Lymphadenitis auftreten, die konventionellen Behandlungsmethoden nicht zugänglich ist. Nur eine detaillierte umfassende Untersuchung solcher Patienten mittels Röntgen, indirekter Radionuklid-Scan-Lymphographie mit einer kolloidalen 198 Au-Lösung und immundiagnostischen Tests kann die Diagnose einer sekundären (posttraumatischen) Aktinomykose der submandibulären Lymphknoten sicher gestellt werden.
Es ist möglich, dass Frakturen des Unterkiefers gleichzeitig durch Aktinomykose und Tuberkulose kompliziert werden (häufiger bei Patienten mit Tuberkulose). Es kann auch seltenere, aber nicht weniger schwere Komplikationen von Kiefer- und Gesichtsverletzungen geben: Jansoul-Ludwig-Angina; späte Blutung nach Osteosynthese, kompliziert durch Entzündung; Asphyxie nach intermaxillärer Traktion, die manchmal zum Tod des Patienten aufgrund von Blutaspiration während einer Blutung aus der Zungen- oder Halsschlagader führt; falsches Aneurysma der Gesichtsarterie; Thrombose der inneren Halsschlagader; sekundäre Gesichtslähmung (mit einer Fraktur des Unterkiefers); Gesichtsemphysem (mit einer Fraktur des Oberkiefers); Pneumothorax und Mediastinitis (mit einer Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers) usw.
Die Dauer des Krankenhausaufenthalts der Patienten hängt von der Lokalisation der Verletzung im Kiefer- und Gesichtsbereich, dem Verlauf der Konsolidierungsphase und dem Auftreten von Komplikationen ab.
Die angegebenen Bedingungen sind nicht optimal. Mit der Überwindung der Wirtschaftskrise und dem Ausbau der Krankenhausbettenkapazität wird es künftig möglich sein, den Krankenhausaufenthalt von Patienten bis zum vollständigen Abschluss der Behandlung von Gesichtstraumata verschiedener Lokalisationen zu verlängern. Patienten mit Kiefer- und Gesichtsverletzungen aus ländlichen Gebieten müssen länger im Krankenhaus bleiben, da sie aufgrund der Entfernung in der Regel nicht zur ambulanten Beobachtung und Behandlung in die Stadt kommen können. Die Verfügbarkeit einer gut ausgebauten Traumaversorgung und Rehabilitationsräume für Patienten mit solchen Verletzungen in zahnmedizinischen Einrichtungen der Stadt ermöglicht eine leichte Verkürzung ihres Krankenhausaufenthalts.
Ambulante Behandlung (Rehabilitation) von Opfern mit Verletzungen der Kiefer- und Gesichtsregion
Die Organisation der ambulanten Behandlungsphase von Opfern mit Verletzungen der Kiefer- und Gesichtsregion ist nicht immer ausreichend klar, da die Patienten in vielen Fällen unter der Aufsicht von Ärzten verschiedener Institutionen stehen, die nicht über eine ausreichende Ausbildung im Bereich der Kiefer- und Gesichtstraumatologie verfügen.
In diesem Zusammenhang kann empfohlen werden, die Erfahrungen des Rehabilitationsraums der Kiefer- und Gesichtsklinik des Staatlichen Instituts für Höhere Medizinische Studien in Zaporizhzhya und der regionalen Zahnklinik zu nutzen, die in ihrer Praxis Austauschkarten eingeführt haben, die alle Informationen über die Behandlung des Opfers im Krankenhaus, in der Klinik am Wohnort und im Rehabilitationsraum enthalten.
Bei der Rehabilitation von Patienten mit Kiefer- und Gesichtsverletzungen sollte berücksichtigt werden, dass solche Verletzungen häufig mit geschlossenen Schädel-Hirn-Verletzungen einhergehen und zudem mit Funktionsstörungen und Strukturstörungen der Kiefergelenke (TMJ) einhergehen. Der Schweregrad dieser Erkrankungen hängt vom Frakturort ab: Bei Kondylenfortsatzfrakturen werden degenerative Veränderungen in beiden Gelenken häufiger beobachtet als bei extraartikulären Frakturen. Anfänglich haben diese Erkrankungen den Charakter einer funktionellen Insuffizienz, die sich nach 2-7 Jahren zu degenerativen Veränderungen entwickeln kann. Nach Einzelfrakturen entwickelt sich eine einseitige Arthrose auf der Seite der Verletzung, nach Doppel- und Mehrfachfrakturen eine beidseitige. Darüber hinaus zeigen alle Patienten mit Unterkieferfrakturen, gemessen an den Daten der Elektromyographie, ausgeprägte Veränderungen der Kaumuskulatur. Um die Kontinuität in der Nachbehandlung von Traumapatienten in Zahnkliniken zu gewährleisten, sollten diese daher von einem Zahnarzt-Traumatologen untersucht werden, der Patienten mit Gesichtsverletzungen jeglicher Lokalisation umfassend behandelt.
Besonderes Augenmerk sollte auf die Vorbeugung von Komplikationen entzündlicher Natur und psychoneurologischen Störungen gelegt werden - Kephalgien, Meningoenzephalitis, Arachnoiditis, autonome Störungen, Hör- und Sehstörungen usw. Zu diesem Zweck ist es notwendig, physiotherapeutische Behandlungsmethoden und Bewegungstherapie umfassender einzusetzen. Es ist notwendig, den Zustand der Fixierverbände in der Mundhöhle, den Zustand der Zähne und der Schleimhäute sorgfältig zu überwachen und rechtzeitig und rational Zahnersatz durchzuführen. Bei der Festlegung der Immobilisierungsbedingungen, der Dauer der vorübergehenden Behinderung und der Behandlung ist es notwendig, jeden Patienten individuell unter Berücksichtigung der Art der Verletzung, des Krankheitsverlaufs, des Alters und des Berufs des Patienten zu behandeln.
Der Patient muss die Behandlung in der Rehabilitationspraxis absolvieren. Daher erhält der Arzt dieser Praxis durch eine besondere Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes das Recht, Bescheinigungen über vorübergehende Arbeitsunfähigkeit unabhängig vom Arbeits- und Wohnort des Patienten auszustellen und zu verlängern. Es ist wünschenswert, eine zahnärztliche Rehabilitationspraxis für 200.000 bis 300.000 Menschen einzurichten. Bei einer Abnahme der Verletzungshäufigkeit können die Aufgaben der Praxis erweitert werden, indem chirurgische Patienten anderer Profile betreut werden, die zur ambulanten Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.
In ländlichen Gebieten sollte die Nachbehandlung von Opfern mit Verletzungen der Kiefer- und Gesichtsregion in Kreiskliniken (Krankenhäusern) unter Aufsicht eines Kreiszahnarztes erfolgen.
Das Behandlungssystem für Patienten mit Gesichtstraumata sollte eine systematische Untersuchung der langfristigen Behandlungsergebnisse beinhalten.
Stationäre Zahnabteilungen regionaler Krankenhäuser und regionaler (territorialer) Zahnkliniken müssen organisatorische und methodische Leitlinien für die Bereitstellung zahnärztlicher Versorgung in der Region umsetzen, auch für Patienten mit Gesichtstraumata.
Zentren für spezialisierte Zahnmedizin sind häufig klinische Stützpunkte für Abteilungen für Kieferchirurgie an medizinischen Universitäten und Instituten (Akademien, Fakultäten) zur Weiterbildung von Ärzten. Die Anwesenheit hochqualifizierten Personals ermöglicht die breite Anwendung modernster Methoden zur Diagnostik und Behandlung verschiedener Verletzungen der Kiefer- und Gesichtsregion und ermöglicht zudem erhebliche Einsparungen.
Der Chefzahnarzt und Kieferchirurg der Region, des Territoriums, der Stadt sowie der Leiter der Kiefer- und Gesichtsabteilung stehen vor folgenden Aufgaben, um die Versorgung von Opfern von Gesichtstraumata zu verbessern:
- Prävention von Verletzungen, einschließlich Ermittlung und Analyse der Ursachen von Arbeitsunfällen, insbesondere in der landwirtschaftlichen Produktion; Teilnahme an allgemeinen Präventivmaßnahmen zur Verhütung von Arbeits-, Verkehrs-, Straßen- und Sportunfällen; Prävention von Verletzungen bei Kindern; Durchführung umfassender Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung, insbesondere bei jungen Menschen im erwerbsfähigen Alter, zur Verhütung von Verletzungen im Haushalt.
- Entwicklung notwendiger Empfehlungen für die Bereitstellung von Erster Hilfe und Erster medizinischer Hilfe für Patienten mit Gesichtstraumata in Gesundheitszentren, Sanitätsstationen, Traumazentren, Krankenwagenstationen; Einarbeitung von medizinischem Personal der mittleren Ebene und Ärzten anderer Fachrichtungen in Elemente der Ersten Hilfe und Ersten medizinischen Hilfe bei Gesichtstraumata.
- Organisation und Durchführung fortlaufender Spezialisierungs- und Weiterbildungszyklen für Zahnärzte, Chirurgen, Traumatologen und Allgemeinmediziner zu Fragen der Versorgung von Patienten mit Gesichtsverletzungen.
- Anwendung und Weiterentwicklung der modernsten Methoden zur Behandlung von Kieferfrakturen; Vorbeugung von Komplikationen, insbesondere entzündlicher Natur; breitere Anwendung komplexer Methoden zur Behandlung traumatischer Gesichtsverletzungen.
- Ausbildung von medizinischem Personal mittlerer Ebene in Grundkenntnissen zur Ersten Hilfe für Patienten mit Gesichts- und Kieferverletzungen.
Bei der Analyse der Qualitätsindikatoren zahnärztlicher Einrichtungen sollte auch der Versorgungszustand von Patienten mit Gesichtsverletzungen berücksichtigt werden. Besonderes Augenmerk sollte auf die Analyse von Behandlungsfehlern gelegt werden. Es sollte zwischen diagnostischen, therapeutischen und organisatorischen Fehlern unterschieden werden, für die empfohlen wird, ein spezielles Tagebuch (für jede Stadt und jeden Bezirk) zu führen.
Auswahl der Methode zur Reposition und Fixierung von Kieferfragmenten bei alten Frakturen
Je nach Alter der Ober- oder Unterkieferfraktur und dem Grad der Steifheit der Fragmente kommen orthopädische oder chirurgische Methoden zum Einsatz. So werden bei Frakturen des Alveolarfortsatzes im Oberkiefer mit schwer zu behebender Fragmentverschiebung Schienen aus Stahldraht zur skelettalen Traktion verwendet. Die Elastizität des Stahldrahts erleichtert die horizontale und vertikale Reposition des Fragments. Insbesondere wenn ein Fragment des vorderen Abschnitts des Alveolarfortsatzes nach hinten verschoben ist, wird eine glatte Schienenhalterung angelegt und in üblicher Weise an den Zähnen auf beiden Seiten der Frakturlinie befestigt; die Zähne des Fragments werden mit sogenannten „Suspensionsligaturen“ unter leichter Spannung am Draht befestigt. Allmählich (auf einmal oder über mehrere Tage – je nach Alter der Fraktur) wird das Fragment des Alveolarfortsatzes durch Drehen des Ligaturdrahts langsam reponiert. Zum gleichen Zweck können auch dünne Gummiringe verwendet werden, die den Zahnhals umschließen und vorne auf einem Draht befestigt werden, der in diesem Fall nicht unbedingt aus Stahl sein muss.
Ist der seitliche Abschnitt des Alveolarfortsatzes im Oberkiefer nach innen verschoben, wird die Stahldrahtschiene in die Form des normalen Zahnbogens gebogen. Allmählich kehrt das Fragment in die richtige Position zum unteren Zahnbogen zurück. Ist der seitliche Abschnitt des Alveolarfortsatzes nach außen verschoben, wird er mithilfe eines elastischen Zugs, der über den harten Gaumen gelegt wird, nach innen korrigiert.
Bei einer Steifheit des nach unten verlagerten Alveolarfortsatzfragments im Oberkiefer können zur Traktion Gummiringe oder ein Shelgorn-Verband verwendet werden, der durch die Oberfläche der Zahnokklusion angelegt wird.
Bei Steifheit der Unterkieferfragmente wird eine intermaxilläre Traktion mithilfe von Zahnschienen durchgeführt. Sind die steifen Kieferfragmente zahnlos, können Vorrichtungen zur Reposition und Fixierung der Fragmente eingesetzt werden oder die Reposition und Fixierung kann über einen extraoralen oder intraoralen Zugang erfolgen.
Untersuchung auf vorübergehende Behinderung bei Kieferbrüchen
Jeder Bürger hat das Recht auf finanzielle Sicherheit im Alter, im Krankheitsfall, bei vollständigem oder teilweisem Verlust der Erwerbsfähigkeit sowie bei Verlust des Ernährers.
Dieses Recht wird durch die Sozialversicherung der Arbeiter, Angestellten und Bauern, Leistungen bei vorübergehender Erwerbsunfähigkeit und viele andere Formen der sozialen Sicherheit gewährleistet.
Von einem Verlust der Arbeitsfähigkeit nach einer Verletzung spricht man, wenn die Unfähigkeit besteht, eine gesellschaftlich nützliche Arbeit zu verrichten, ohne dass die Gesundheit und die Produktionseffizienz beeinträchtigt werden.
Bei Kieferfrakturen ist sowohl ein vorübergehender als auch ein dauerhafter Verlust der Arbeitsfähigkeit möglich, letzterer wird in vollständige und teilweise unterteilt.
Wenn die Kieferfunktionsstörungen, die eine Berufstätigkeit verhindern, reversibel sind und durch eine Behandlung verschwinden, handelt es sich um eine vorübergehende Behinderung. Bei einer vollständigen vorübergehenden Behinderung kann der Betroffene keine Arbeit mehr verrichten und benötigt eine Behandlung nach ärztlichem Behandlungsplan. Beispielsweise gelten Patienten mit Kieferfrakturen in der akuten Verletzungsphase mit starken Schmerzen und Funktionsstörungen als vorübergehend vollständig behindert.
Eine teilweise vorübergehende Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn der Betroffene zwar nicht in der Lage ist, in seinem Fachgebiet zu arbeiten, aber ohne gesundheitliche Schäden andere Tätigkeiten ausüben kann, die Ruhe oder eine akzeptable Belastung des geschädigten Organs gewährleisten. Beispielsweise ist ein Bergmann in einem Bergwerk mit einer Unterkieferfraktur und verzögerter Fragmentverfestigung in der Regel 1,5 bis 2 Monate arbeitsunfähig. Nach Beseitigung der akuten Erscheinungen 1,5 Monate nach der Verletzung kann der Arbeitnehmer jedoch auf Beschluss des VKK (für einen Zeitraum von höchstens 2 Monaten) in eine leichtere Tätigkeit versetzt werden: als Hebezeugführer, Lader in einem Lampenraum usw. Bei einem Wechsel an einen anderen Arbeitsplatz aufgrund der Folgen einer Kieferfraktur werden keine Krankmeldungen ausgestellt.
Eine fachärztliche Untersuchung des Verletzten sollte mit der Feststellung der korrekten Diagnose beginnen, die zur Bestimmung der Arbeitsprognose beiträgt. Manchmal berücksichtigt der Arzt nach der korrekten Diagnose die Arbeitsprognose nicht. Infolgedessen wird der Verletzte entweder vorzeitig entlassen oder sein Krankenstand wird nach Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit unangemessen verlängert. Ersteres führt zu verschiedenen Komplikationen, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken und die Behandlung verzögern; letzteres führt zu ungerechtfertigten Ausgaben für die Bezahlung des Krankenstands.
Das wichtigste Differenzialkriterium für den vorübergehenden Verlust der Arbeitsfähigkeit ist daher eine günstige klinische und berufliche Prognose, die durch eine vollständige oder signifikante Wiederherstellung der verletzungsbedingten Kieferfunktionsstörung und der Arbeitsfähigkeit in relativ kurzer Zeit gekennzeichnet ist. Die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit bei Kieferfrakturen ist durch den Grad der Wiederherstellung der Funktion des beschädigten Kiefers gekennzeichnet, nämlich: gute Konsolidierung der Fragmente in der richtigen Position, Erhalt des normalen Zahnschlusses, ausreichende Beweglichkeit der Kiefergelenke, Fehlen ausgeprägter Störungen der Blut- und Lymphzirkulation, Schmerzen und anderer Störungen, die mit einer Schädigung der peripheren Nerven im Kiefer- und Gesichtsbereich verbunden sind.
Vorübergehender Verlust der Arbeitsfähigkeit aufgrund von Kieferfrakturen kann durch Arbeitsunfälle und häusliche Traumata verursacht werden. Die Ermittlung der Ursache für vorübergehenden Verlust der Arbeitsfähigkeit aufgrund von Kieferfrakturen ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Zahnarztes, da dies die Lösung von Problemen erfordert, die nicht nur medizinische, sondern auch rechtliche Kompetenz erfordern.
In folgenden Fällen gilt eine Erkrankung als Arbeitsunfall: bei der Ausübung der Arbeit (einschließlich einer Geschäftsreise während der Arbeitszeit), bei der Durchführung einer Handlung im Interesse eines Unternehmens oder einer Firma, auch ohne deren Ermächtigung; bei der Wahrnehmung öffentlicher oder staatlicher Aufgaben sowie im Zusammenhang mit der Erfüllung besonderer Aufträge des Staates, der Gewerkschaften oder anderer öffentlicher Organisationen, auch wenn diese Aufträge nicht mit dem jeweiligen Unternehmen oder der jeweiligen Institution in Zusammenhang stehen; auf dem Gelände eines Unternehmens oder einer Institution oder an einem anderen Arbeitsplatz während der Arbeitszeit, einschließlich der festgelegten Pausen, sowie während der Zeit, die zum Instandsetzen von Produktionswerkzeugen, Kleidung usw. vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende erforderlich ist; in der Nähe eines Unternehmens oder einer Institution während der Arbeitszeit, einschließlich der festgelegten Pausen, sofern der Aufenthalt dort nicht den Regeln des festgelegten Arbeitsablaufs widerspricht; auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause; bei der Wahrnehmung der bürgerlichen Pflicht, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, Menschenleben zu retten und Staatseigentum zu schützen.
Zur Feststellung der Ursache einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit ist ein Unfallbericht erforderlich, der von der Verwaltung des Unternehmens, in dem sich der Unfall ereignet hat, zeitnah und ordnungsgemäß erstellt wird. Der Bericht muss angeben, dass sich der Unfall während der Arbeit ereignet hat, seine Art beschreiben usw. Bei Gruppenunfällen muss für jedes Opfer ein Bericht erstellt werden.
Ein Gesetz kann nicht erlassen werden, wenn sich der Unfall auf dem Weg zur oder von der Arbeit ereignet hat. In diesen Fällen sind eine Bescheinigung der Verkehrsverwaltung, ein polizeilicher Bericht, eine Bescheinigung des Unternehmens oder der Einrichtung, in der der Verletzte arbeitet, aus der Beginn und Ende seiner Arbeit an diesem Tag hervorgehen, sowie eine Wohnsitzbescheinigung erforderlich.
Die größten Schwierigkeiten ergeben sich bei der Bestimmung der Art des Verlusts der Arbeitsfähigkeit (vorübergehend oder dauerhaft) sowie bei der Feststellung des Enddatums des vorübergehenden Verlusts der Arbeitsfähigkeit, das für jeden Patienten individuell ist.
Es ist zu berücksichtigen, dass in manchen Fällen die Dauer der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit nicht mit der Dauer übereinstimmt, für die dem Patienten eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt wird (z. B. bei einem häuslichen Unfall usw.). Um die durchschnittliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu charakterisieren, ist es daher erforderlich, den Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt der Verletzung und der Rückkehr des Opfers an den Arbeitsplatz genau anzugeben.
Patienten mit Kieferfrakturen werden nach Beendigung der stationären Behandlung ambulant weiterbehandelt. Bis zur Feststellung ihrer Behinderungsgruppe wird der Verlust der Arbeitsfähigkeit durch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dokumentiert. Die Dauer der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für Patienten, die später als behindert anerkannt werden, lässt sich jedoch nicht mit der durchschnittlichen Dauer der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit gleichsetzen. Dieser Zeitraum vor der Einstufung des Patienten als behindert wird korrekterweise als Vor-Invaliditätsphase bezeichnet.
Bei der Festlegung der Dauer der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit müssen nicht nur die Art der Verletzung, sondern auch der Beruf des Patienten, seine Arbeits- und Lebensbedingungen sowie die Art der Verletzung (Arbeits- oder Haushaltsverletzung usw.) berücksichtigt werden. So wird die Arbeitsfähigkeit bei relativ leichten Sportverletzungen am schnellsten wiederhergestellt; bei Arbeits- und Transportverletzungen ist die Dauer der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit länger.
Um eine mögliche Verschlimmerung auszuschließen, sollten objektive Untersuchungsmethoden wie Palpation, Kauen, Röntgen und Osteometrie umfassend eingesetzt werden.
Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit bei Kieferfrakturen hängt auch von den beruflichen Besonderheiten des Betroffenen ab: Bei geistig behinderten Menschen ist die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit kürzer als bei körperlich behinderten Menschen; sie können 20-25 Tage nach der Verletzung wieder arbeiten und die Behandlung ambulant fortsetzen. Gleichzeitig dürfen Patienten, deren Beruf mit ständiger Anspannung und Bewegung der Muskulatur der Kiefer- und Gesichtsregion verbunden ist (Künstler, Dozenten, Musiker, Lehrer usw.), erst nach vollständiger Wiederherstellung der Kieferfunktion wieder arbeiten.
Die Dauer der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit ist besonders lang bei Patienten, die schwere körperliche Arbeit verrichten. Für diese Patientengruppe verlängert sich der Krankenstand nach dem Entfernen der Fixierschienen und -vorrichtungen um weitere 2-3 Tage, um den Kauvorgang vollständig zu regulieren. Bei vorzeitiger Entlassung können Komplikationen auftreten (Osteomyelitis, Kieferrefrakturen usw.). Darüber hinaus sind solche Patienten oft nicht in der Lage, grundlegende Arbeitsprozesse in vollem Umfang durchzuführen. Beispielsweise sind Arbeiter im Steinkohlenbergbau länger arbeitsunfähig als Arbeiter in anderen Berufen. Dies ist auf die besonderen Besonderheiten der Arbeit unter Tage und die Art der Verletzungen zurückzuführen, die oft mit Schäden an den Weichteilen des Gesichts einhergehen.
Bei Menschen über 50 Jahren verlängert sich die Dauer der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Verlangsamung der Konsolidierung.
Die Konsolidierung der Unterkieferfraktur dauert bei Patienten mit Parodontitis 1,5–2 Monate länger. Bei Patienten ohne Parodontitis tritt sie durchschnittlich 3–4 Monate nach der Verletzung ein. Bei der Bestimmung der Fixierungsdauer und der Dauer der vorübergehenden Behinderung sollten auch Umweltfaktoren berücksichtigt werden.
Der Einsatz extrafokaler Kompressionsmethoden zur Behandlung von Kieferfrakturen in Kombination mit allgemeinen Auswirkungen auf den Körper und der Behandlung von Parodontitis sowie rechtzeitige und rationelle lokale orthopädische und chirurgische Maßnahmen zur Neupositionierung und Fixierung von Kieferfragmenten tragen dazu bei, die Dauer der vorübergehenden Behinderung zu verkürzen.
Während sich die Frage der Arbeitsfähigkeit in der akuten Verletzungsphase relativ einfach beantworten lässt, ist es später, wenn bestimmte Komplikationen (zögernde Fragmentkonsolidierung, Kontraktur, Ankylose etc.) auftreten, schwierig, Dauer und Art der Arbeitsunfähigkeit zu bestimmen. Anhand der Art der Fraktur, ihres klinischen Verlaufs und der aufgetretenen Komplikationen muss der Zahnarzt die Dauer der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit des Verletzten zumindest annähernd bestimmen und eine korrekte Arbeitsprognose erstellen, die das Kriterium für die Feststellung einer vorübergehenden oder dauerhaften Arbeitsunfähigkeit ist.
Die Arbeitsprognose kann günstig, ungünstig oder fraglich sein. Bei einer günstigen Arbeitsprognose ist es möglich, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen und den Verletzten in seine vorherige oder gleichwertige Tätigkeit zurückzuführen. Die Arbeitsprognose ist ungünstig, wenn der Verletzte aufgrund der Verletzung oder ihrer Komplikationen nicht in seinem Fachgebiet arbeiten kann und eine Versetzung an einen anderen, seinem Gesundheitszustand entsprechenden Arbeitsplatz erforderlich ist oder wenn der Verletzte arbeitsunfähig ist. Eine fragliche Arbeitsprognose bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Daten vorliegen, die zur Klärung des Ausgangs der Kieferfraktur und der Möglichkeit der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit erforderlich sind. Bei verzögerter Konsolidierung von Kieferfrakturen, die durch eine traumatische Osteomyelitis kompliziert sind, ist die Prognose mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. In einigen Fällen gelingt es durch chirurgische, physiotherapeutische und andere Behandlungsmethoden, die Fragmente in der richtigen Position zu verschmelzen und die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. In anderen Fällen bilden sich trotz der Behandlung Knochendefekte, die zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit führen.
Es ist zu beachten, dass die Wehenprognose eng mit der klinischen Prognose zusammenhängt, von ihr abhängt, aber nicht immer mit ihr übereinstimmt. So kann selbst bei einem ungünstigen klinischen Verlauf von Kieferfrakturen (Fehlverheilung ohne Bissstörung oder bei zahnlosen Kiefern) die Wehenprognose günstig sein, da sie nicht nur von anatomischen Veränderungen, sondern vor allem vom Grad der Funktionswiederherstellung, der Entwicklung von Kompensationsvorrichtungen, dem Beruf des Betroffenen und anderen Faktoren bestimmt wird.
Untersuchung auf vorübergehende Behinderung bei Unterkieferfrakturen
Die durchschnittliche Dauer der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit bei Unterkieferfrakturen beträgt 43,4 Tage. Die Dauer der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit hängt von der Lokalisation der Frakturen ab. Bei Frakturen im Bereich des Kondylenfortsatzes und des Kieferastes mit guter Ausrichtung der Knochenfragmente ist die Dauer der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit minimal (36,6 Tage). Frakturen dieser Lokalisation sind in der Regel geschlossen und nicht infiziert.
Die Hauptfaktoren für eine schnelle Konsolidierung sind eine gute Blutversorgung des Knochens im Frakturbereich und das Vorhandensein einer Muskelhülle, die es ermöglicht, die intermaxilläre Gummitraktion am 12.-14. Tag zu entfernen. Eine frühzeitige funktionelle Behandlung trägt dazu bei, die Konsolidierung der Kieferfragmente zu beschleunigen.
Die Behandlung von Opfern mit Frakturen und Luxationen der Kondylenfortsätze des Unterkiefers ist mit großen Schwierigkeiten verbunden, weshalb die Dauer der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit von Personen, die körperliche Arbeit verrichten, durchschnittlich 60 Tage beträgt.
Zur Beurteilung des Konsolidierungsgrades von Kieferfragmenten empfiehlt sich die Verwendung des Echoosteometers EOM-01-ts mit einer Schwingfrequenz von 120 ± 36 kHz. Der Echoosteometrie-Indikator normalisiert sich beispielsweise bei Verwendung des extrafokalen Geräts von VA Petrenko et al. (1987) zur Behandlung von Kondylenfortsatzfrakturen nahezu erst am 90. Tag. Daher ist es offensichtlich, dass der in den „Methodischen Empfehlungen“ festgelegte 60-Tage-Zeitraum wissenschaftlicher Rechtfertigung oder Änderungen unterliegt, insbesondere in Bereichen mit radioaktiver, industrieller und chemischer Kontamination von Boden, Wasser und Lebensmitteln.
Bei Unterkieferfrakturen mit einem Zahn im Frakturspalt ist die Dauer der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit deutlich länger als bei Frakturen außerhalb des Zahnbogens.
Bei zentralen Frakturen des Unterkiefers ist die Erholungszeit bis zur Erlangung der Arbeitsfähigkeit nahezu gleich wie bei Frakturen im seitlichen Bereich (44,2 Tage).
Die Erholungszeit bei Einzelfrakturen des Unterkiefers beträgt durchschnittlich 41,2 Tage, bei Patienten mit Doppelfrakturen 44,8 Tage. Mehrfachfrakturen des Unterkiefers sind am schwerwiegendsten, da sie fast immer mit einer erheblichen Verschiebung von Fragmenten einhergehen, die in die Mundhöhle hineinragen können. Solche Frakturen sind offen und anfällig für Infektionen. Die durchschnittliche Dauer der vorübergehenden Behinderung beträgt für sie 59,6 Tage.
Bei Trümmerfrakturen des Unterkiefers ist die Zeit bis zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit etwas länger als bei linearen Frakturen und beträgt im Durchschnitt 45,5 Tage.
Bei Patienten mit Unterkieferfrakturen in Kombination mit einer Gehirnerschütterung erhöht sich die durchschnittliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit auf 47,4 Tage. Die Frage der Möglichkeit einer Entlassung solcher Patienten aus dem Krankenhaus sollte gemeinsam mit einem Neurologen entschieden werden.
Die Dauer des Verlustes der Arbeitsfähigkeit hängt auch von den Behandlungsmethoden der Unterkieferfrakturen ab. Die Wiederherstellungszeit der Arbeitsfähigkeit bei Patienten mit Unterkieferfrakturen, die nicht-chirurgisch behandelt wurden, beträgt durchschnittlich 43,7 Tage, bei chirurgischen Methoden 41,3 Tage. Die geringsten Zeiträume des vorübergehenden Verlustes der Arbeitsfähigkeit werden bei der Behandlung von Unterkieferfrakturen ohne Fragmentverschiebung mit selbsthärtenden Kunststoffkappen (26,3 Tage) und schlingenförmigen Verbänden nach ZI Urbanskaya (36,7 Tage) beobachtet. Die Arbeitsfähigkeit von Opfern, die zur Behandlung von Unterkieferfrakturen zahnärztliche Zweikiefer-Aluminiumschienen erhielten, war später (nach 44,6 Tagen) wiederhergestellt.
Die Hauptgründe für die Verlängerung der Zeit bis zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit sind eine langfristige intermaxilläre Fixierung ohne Einsatz einer frühfunktionellen Behandlung, die relative Beweglichkeit der Fragmente, ein Trauma der Interdentalpapillen des Zahnfleisches durch Drahtschienen, eine Lockerung der Zähne usw.
 [ 18 ]
[ 18 ]
Untersuchung auf vorübergehende Behinderung bei Oberkieferfrakturen
Die durchschnittliche Dauer der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Oberkieferfrakturen beträgt 64,9 Tage.
Die durchschnittliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit hängt von der Art der Oberkieferverletzung ab: Bei einem Nicht-Arbeitsunfall beträgt sie 62,5 Tage, bei einem Arbeitsunfall 68,3 Tage.
Die Dauer der verletzungsbedingten Arbeitsunfähigkeit wird in gewissem Maße von der Schwere der Verletzung bestimmt. Die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit nach einer Fraktur des Alveolarfortsatzes des Oberkiefers erfolgt durchschnittlich innerhalb von 43,6 Tagen, bei einer Fraktur des Oberkieferkörpers beträgt die durchschnittliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit 69,9 Tage; nach Typ Le Fort I - 56,0 Tage, nach Typ Le Fort II - 65,4 Tage und nach Typ Le Fort III - 74,7 Tage.
Bei unkomplizierten Frakturen des Oberkiefers beträgt die Arbeitsunfähigkeitsdauer durchschnittlich 60,1 Tage, bei komplizierten Frakturen 120–130 Tage.
Ein Merkmal von Oberkieferfrakturen ist ihre kombinierte Natur aufgrund der anatomischen Nähe der Gesichts- und Hirnteile des Schädels. Traumatische Verletzungen der Schädel- und Hirnknochen werden von Zahnärzten nicht immer diagnostiziert, was sich negativ auf die Behandlung der Patienten auswirkt.
Die Dauer der vorübergehenden Behinderung bei isolierten und kombinierten Oberkieferfrakturen ist unterschiedlich. So beträgt sie bei einer Oberkieferfraktur in Kombination mit einer Gehirnerschütterung 70,8 Tage, bei einer Kombination mit einer Unterkieferfraktur durchschnittlich 73,3 Tage, bei einer Schädelbasisfraktur 81,0 Tage, bei einer Schädelgewölbefraktur 126,7 Tage, bei einer Augenhöhlenschädigung 120,5 Tage und bei einer Fraktur anderer Knochen 89,5 Tage.
Mehrere Frakturen der Gesichts-, Schädel- und Rumpfknochen führen zu einer vorübergehenden Behinderung von bis zu 87,5 Tagen.
Die Dauer der vorübergehenden Behinderung hängt auch von der Behandlungsmethode der Oberkieferfrakturen ab. Bei orthopädischen Behandlungsmethoden beträgt die durchschnittliche Dauer der vorübergehenden Behinderung 59,2 Tage (55,4 Tage bei unkomplizierten und 116,0 Tage bei komplizierten Frakturen), bei chirurgischen Methoden 76,0 Tage (69,3 Tage bei unkomplizierten und 153,5 Tage bei komplizierten Frakturen).
Die längere Dauer der vorübergehenden Behinderung bei chirurgischen Methoden der Frakturbehandlung ist darauf zurückzuführen, dass diese bei schwersten Verletzungen eingesetzt werden, wenn orthopädische Methoden nicht angezeigt oder unwirksam sind.
 [ 19 ]
[ 19 ]
Anmeldung einer vorübergehenden Behinderung
Ein Zahnarzt ist berechtigt, einem Patienten mit einer Kieferfraktur eine Krankschreibung für einen Zeitraum von höchstens sechs Tagen auszustellen. Medizinische Kontrollkommissionen (MCC) sind berechtigt, die Krankschreibung für einen längeren Zeitraum (bei Patienten mit einer Verletzung jeweils bis zu 10 Tage) zu verlängern, in der Regel jedoch nicht länger als 4 Monate ab dem Datum der Verletzung. In diesem Fall sind die Personen, die die Verlängerung der Krankschreibung genehmigen, verpflichtet, den Patienten persönlich zu untersuchen. Bei einem langfristigen Krankheitsverlauf sollten solche Untersuchungen mindestens alle 10 Tage und bei Bedarf deutlich häufiger durchgeführt werden, insbesondere in der ersten Zeit nach der Verletzung.
Bei Verlust der Arbeitsfähigkeit infolge eines Arbeitsunfalls stellt der Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus. Dabei handelt es sich um ein Dokument, das die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit bestätigt und dem Verletzten Anspruch auf Leistungen der Sozialversicherung gibt.
Bei Arbeitsunfähigkeit aufgrund eines häuslichen Unfalls stellt die medizinische Einrichtung eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für fünf Tage und ab dem sechsten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus. Wendet sich der Verletzte an dem Tag, an dem er bereits gearbeitet hat, an den Arzt, stellt dieser gegebenenfalls eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit Datum vom Tag der Anfrage aus, entbindet den Verletzten jedoch erst ab dem nächsten Tag von der Arbeit.
Patienten mit Kieferbrüchen, die im Krankenhaus behandelt werden, erhalten bei der Entlassung eine Krankschreibung, bei längerem Krankenhausaufenthalt kann jedoch vor der Entlassung eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt werden, um Lohnfortzahlung zu erhalten.
Wird die Arbeitsfähigkeit des Patienten durch die stationäre Behandlung wiederhergestellt, wird die Krankschreibung gelöscht. Bleibt der Patient nach der Entlassung aus dem Krankenhaus aufgrund der Folgen der Fraktur arbeitsunfähig, wird die Krankschreibung nicht im Krankenhaus gelöscht, sondern ein entsprechender Vermerk über die Notwendigkeit einer ambulanten Behandlung angebracht. Anschließend wird die Krankschreibung vom Zahnarzt der medizinischen und präventiven Einrichtung, in der der Patient die Behandlung fortsetzt, verlängert. Es ist zu beachten, dass Personen, die durch eine Vergiftung oder bei Handlungen aufgrund einer Vergiftung eine Verletzung erlitten haben und eine ambulante oder stationäre Behandlung benötigen, keine Krankschreibung erhalten.
Die Entlassung eines Patienten aus dem Arbeitsleben oder die Überweisung an die VTEK mit einer einfachen oder komplizierten Oberkieferfraktur richtet sich nach der klinischen und beruflichen Prognose. Bleibt die klinische und berufliche Prognose trotz aller therapeutischen Maßnahmen ungünstig und bleibt die Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit bestehen, sollte die Überweisung an die VTEK erfolgen, um die Invaliditätsgruppe zu bestimmen, beispielsweise bei einer durch Osteomyelitis komplizierten Unterkieferfraktur mit anschließender Bildung eines großen Knochendefekts und bei Bedarf an restaurativer knochenplastischer Chirurgie. In solchen Fällen ermöglichen die rechtzeitige Bestimmung der Invaliditätsgruppe und die Entlassung des Patienten von der Arbeit die Durchführung umfassender therapeutischer Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gesundheit des Betroffenen, wonach er in seinem eigenen oder einem anderen Fachgebiet arbeiten kann. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird mit dem Tag der Ausstellung des VTEK-Gutachtens über die Feststellung der Invalidität, unabhängig von deren Ursache und Gruppe, abgeschlossen.
Eine rationelle Beschäftigung behinderter Menschen ist von großer Bedeutung, da eine machbare Arbeit zu einer schnelleren Wiederherstellung oder Kompensation beeinträchtigter Funktionen beiträgt, den Allgemeinzustand behinderter Menschen verbessert und ihre materielle Sicherheit erhöht.
Manchmal verschlimmern Begleiterkrankungen, die an sich keine nennenswerte Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit verursachen, den Zustand des Patienten und führen in Kombination mit der Grunderkrankung zu einer stärkeren Funktionsbeeinträchtigung. Daher ist bei der Untersuchung der Arbeitsfähigkeit in solchen Fällen äußerste Vorsicht und ein kritischer Ansatz geboten, um das spezifische Gewicht der genannten Veränderungen im Hinblick auf die Verringerung oder den Verlust der Arbeitsfähigkeit richtig einzuschätzen.

