
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Vasomotorische Rhinitis
Facharzt des Artikels
Zuletzt überprüft: 04.07.2025
Der Name Vasomotorische Rhinitis leitet sich von den autonomen Nervenfasern ab, die die glatte Muskulatur der Arterien und Venen innervieren. Bei der Vasomotorischen Rhinitis unterscheidet man zwischen vasokonstriktorischen (sympathischen) und vasodilatatorischen (parasympathischen) Nervenfasern.
V. I. Voyachek definierte die vasomotorische Rhinitis als falsche Rhinitis. In seinem berühmten Lehrbuch „Grundlagen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde“ schrieb er, dass der Name „falsche Rhinitis“ darauf hinweist, dass der Symptomkomplex einer laufenden Nase möglicherweise nicht mit pathologischen Anzeichen einer Entzündung der Nasenschleimhaut einhergeht. Meist handelt es sich dabei um ein Symptom einer allgemeinen vegetativen Neurose und ist daher oft nur ein Glied in einer Reihe entsprechender Erkrankungen, wie beispielsweise Asthma. Somit ist die vasomotorische Rhinitis in ihrer reinen Form funktionell. Eine Unterart dieser Gruppe sind allergische Erkrankungen, bei denen unter dem Einfluss eines Allergens vasomotorische und sekretorische Störungen der Nasenhöhle auftreten.
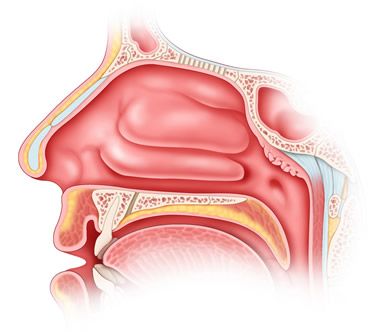
Diese Definition, die vor mehr als einem halben Jahrhundert formuliert wurde, ist auch heute noch relevant, da das Problem der chronischen vasomotorischen (neurovegetativen) und allergischen Rhinitis aus vielen Aspekten der medizinischen und biologischen Wissenschaft (Immunologie, Allergologie, neurovegetative Neurosen usw.) untersucht wurde. Nach Ansicht einer Reihe von Autoren spielen letztere die wichtigste Rolle in der Pathogenese der echten vasomotorischen Rhinitis, die in ihrer klassischen Manifestation nicht von entzündlichen Reaktionen begleitet wird.
Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es die durch Endo- oder Exoallergene hervorgerufenen vegetativ-vaskulären Funktionsstörungen der Nase sind, die durch entzündliche Prozesse kompliziert werden können; in diesen Fällen ist die primäre Allergie der wichtigste ätiologische Faktor für die Entwicklung einer vasomotorischen Rhinitis. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die moderne Einteilung der vasomotorischen Rhinitis in neurovegetative und allergische Formen weitgehend willkürlich und hauptsächlich didaktischer Natur ist. Offenbar handelt es sich dabei um zwei Seiten eines pathologischen Zustands.
In ihrer „reinen Form“ kann die neurovegetative Form der vasomotorischen Rhinitis bei allen Reizprozessen in der Nasenhöhle beobachtet werden, beispielsweise verursacht durch einen Kontaktdorn der Nasenscheidewand, der die vegetativen Enden des perivaskulären Nervs der unteren Nasenwülste reizt. Dieser Mechanismus kann jedoch später den Übergang der neurovegetativen Form zu einer allergischen Form provozieren. Es ist auch möglich, dass die nasalen Manifestationen der neurovegetativen Form der vasomotorischen Rhinitis eine Folge einer allgemeinen vegetativen Neurose sind; in diesem Fall können wir auch andere Manifestationen dieser Neurose beobachten, beispielsweise Anzeichen einer neurozirkulatorischen Dystonie, Hypotonie, Angina pectoris usw.
Bei der Entstehung der neurovegetativen Form der vasomotorischen Rhinitis können pathologische Zustände der Halswirbelsäule, die sich durch Veränderungen der zervikalen sympathischen Knoten manifestieren, eine wichtige Rolle spielen. Somit lässt sich in der Ätiologie und Pathogenese der vasomotorischen Rhinitis ein ganzer Komplex systemischer pathologischer Zustände nachverfolgen, bei dem eine laufende Nase nur die „Spitze des Eisbergs“ einer tieferen und weiter verbreiteten Erkrankung ist. Eine wichtige Rolle bei der Entstehung einer vasomotorischen Rhinitis können provozierende Faktoren spielen, zu denen Berufsrisiken, Rauchen, Alkoholismus und Drogenabhängigkeit zählen. Andererseits können bei primär auftretender vasomotorischer und allergischer Rhinitis spezifische Auslöser (Triggermechanismen) die Rolle spielen, die zu weiter verbreiteten und schwerwiegenderen neurovaskulären Erkrankungen wie Migräne, perivaskulärer Neuralgie, Diencephalon-Syndrom usw. führen.
Ursachen und Pathogenese der vasomotorischen Rhinitis
Ursachen und Pathogenese der vasomotorischen Rhinitis: Die allergische Form der vasomotorischen Rhinitis wird in saisonale (periodische) und konstante (ganzjährige) Rhinitis unterteilt.
Saisonale Rhinitis ist eines der Syndrome der Pollinose (Pollenallergie, Pollenfieber), die hauptsächlich durch entzündliche Läsionen der Schleimhäute der Atemwege und der Augen gekennzeichnet ist. Im Falle einer erblichen Veranlagung für Pollinose verursacht Pflanzenpollen eine Sensibilisierung des Körpers, d. h. die Produktion von Antikörpern gegen das Pollenallergen, wodurch, wenn dieses auf die Schleimhaut gelangt, eine Reaktion der Wechselwirkung des Antigens mit dem Antikörper entsteht, die sich in Entzündungszeichen äußert. Pathognomonische Manifestationen der saisonalen Rhinitis sind saisonale Anfälle von akuter Rhinitis und Konjunktivitis. In schweren Fällen kommt Asthma bronchiale hinzu. Auch eine Pollenintoxikation ist möglich: erhöhte Müdigkeit, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, manchmal ein Anstieg der Körpertemperatur. In Gegenwart chronischer Infektionsherde können sie zur Entwicklung einer akuten Sinusitis während einer Pollinose beitragen. Zu den seltenen Manifestationen zählen Erkrankungen des Nervensystems (Arachnoiditis, Enzephalitis, Schädigung des Seh- und Hörnervs, Entwicklung von Morbus Menière-Anfällen).
Symptome. Ein Anfall von Rhinopathie tritt in der Regel akut, bei bester Gesundheit, Ende Mai und im Juni, während der Blütezeit von Bäumen und Gräsern auf. Er ist gekennzeichnet durch starkes Jucken in der Nase, unkontrollierbares, wiederholtes Niesen, starken wässrigen Nasenausfluss und Atembeschwerden. Gleichzeitig treten auch Anzeichen einer Bindehautentzündung auf. Ein saisonaler Rhinitis-Anfall dauert in der Regel 2-3 Stunden und kann mehrmals täglich auftreten. Die häufigsten äußeren Faktoren können hier eine vasomotorische Rhinitis auslösen: Sonneneinstrahlung oder Zugluft, lokale oder allgemeine Abkühlung usw. Es wird darauf hingewiesen, dass psychischer Stress die Schwere eines Heuschnupfenanfalls verringert oder unterbricht.
Während der anterioren Rhinoskopie in der interiktalen Phase werden keine pathologischen Veränderungen der Nasenschleimhaut festgestellt, jedoch können Deformationen der Nasenscheidewand, Kontaktstacheln und in einigen Fällen isolierte Schleimpolypen vorhanden sein. Während einer Krise wird die Schleimhaut stark hyperämisch oder zyanotisch, ödematös, die Nasenmuscheln vergrößern sich und verstopfen die Nasengänge vollständig, in denen reichlich Schleimausfluss beobachtet wird. Die Gefäße der Nasenmuscheln reagieren scharf, indem sie sich auf die Schmierung mit Adrenalin zusammenziehen. Bei einigen Patienten können Anfälle von saisonaler Rhinitis von Symptomen einer Reizung der Schleimhaut des Kehlkopfes und der Luftröhre (Husten, Heiserkeit, Sekretion von zähflüssigem, transparentem Auswurf) sowie einem asthmatischen Syndrom begleitet sein.
Ständige allergische Rhinitis ist eines der Syndrome des allergischen Zustands des Körpers, der sich durch verschiedene Formen von Allergien manifestiert. In Symptomen und klinischem Verlauf ähnelt es Heuschnupfen. Das Hauptunterscheidungsmerkmal der ständigen allergischen Rhinitis ist das Fehlen von Periodizität, ein mehr oder weniger konstanter Verlauf und eine mäßige Schwere der Anfälle. Allergene bei dieser Form der allergischen Rhinitis können im Gegensatz zur saisonalen Rhinitis verschiedene Substanzen mit antigenen und haptenischen Eigenschaften sein, die eine Person ständig beeinflussen und eine Sensibilisierung des Körpers mit der Bildung von Antikörpern verursachen. Diese Substanzen verursachen bei Kontakt mit Gewebeantikörpern dieselbe "Antigen-Antikörper"-Reaktion wie bei der saisonalen Rhinitis, bei der biologisch aktive Mediatoren (einschließlich Histamin und histaminähnliche Substanzen) freigesetzt werden, die die Rezeptoren der Nasenschleimhaut reizen, eine Erweiterung der Blutgefäße verursachen und die Aktivität der Schleimdrüsen aktivieren.
Symptome einer vasomotorischen Rhinitis
Die Symptome einer vasomotorischen Rhinitis sind gekennzeichnet durch eine periodische oder ständige verstopfte Nase, oft intermittierender Natur, periodisch auftretenden wässrigen Nasenausfluss, auf dem Höhepunkt des Anfalls - Juckreiz in der Nase, Niesen, Druckgefühl in den Tiefen der Nase, Kopfschmerzen. Tagsüber tritt ein Anfall von Niesen und Rhinitis (VI Voyachek nannte diesen Anfall eine "Explosion" der vasomotorischen Reaktion) in der Regel plötzlich auf und vergeht ebenso plötzlich. Er kann bis zu zehnmal täglich oder öfter wiederholt werden. Nachts wird die verstopfte Nase aufgrund des nächtlichen Zyklus der erhöhten Funktion des parasympathischen Nervensystems konstant.
Typisch ist die Verstopfung der Seite der Nase, auf der der Patient liegt, und ihr allmähliches Verschwinden auf der gegenüberliegenden Seite. Dieses Phänomen weist auf eine Schwäche der Vasokonstriktoren hin. Laut VF Undritz, KA Drennova (1956) und anderen führt ein langer Verlauf des funktionellen Stadiums der neurovegetativen Form der vasomotorischen Rhinitis zur Entwicklung des organischen Stadiums (Proliferation von interstitiellem Gewebe und Auftreten einer hypertrophen Rhinitis), was weitgehend durch den übermäßigen Gebrauch von Abschwellmitteln begünstigt wird. Vasokonstriktorische Fasern sind mit adrenergen Nerven verwandt, da bei der Erregungsübertragung auf die Gefäße Noradrenalin in den Synapsen freigesetzt wird. Diese Fasern für die HNO-Organe entspringen dem oberen zervikalen sympathischen Ganglion. Parasympathische Vasodilatatorfasern sind in den Nervi glossopharyngei, facialis, trigeminus und dem Ganglion pterygopalatinum konzentriert.
Bei der anterioren Rhinoskopie werden vergrößerte untere Nasenmuscheln mit einer charakteristischen Färbung festgestellt, die V. I. Voyachek als „grau-weiße Flecken“ definierte. Die unteren Nasenmuscheln fühlen sich weich an und können mit einer Knopfsonde leicht tiefer in die Nasenmuscheln eingeführt werden, ohne die Schleimhaut zu beschädigen. Ein pathognomonisches Zeichen ist eine starke Kontraktion der Nasenmuscheln, wenn sie mit Adrenalin geschmiert werden. Der Geruchssinn ist je nach Schwierigkeitsgrad der Nasenatmung beeinträchtigt.
Allergische Form der vasomotorischen Rhinitis
Allergische Erkrankungen sind seit der Antike bekannt. Hippokrates (5.-4. Jahrhundert v. Chr.) beschrieb Fälle von Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Nahrungsmitteln; K. Galen (2. Jahrhundert n. Chr.) berichtete von einer laufenden Nase, die durch Rosenduft verursacht wurde; im 19. Jahrhundert wurde Heuschnupfen beschrieben und nachweislich durch das Einatmen von Pflanzenpollen verursacht. Der Begriff „Allergie“ wurde 1906 vom österreichischen Kinderarzt C. Pirquet geprägt, um eine ungewöhnliche, veränderte Reaktion mancher Kinder auf die Verabreichung von Anti-Diphtherie-Serum zur Behandlung zu bezeichnen. Substanzen, die atypische (allergische) Reaktionen hervorrufen, wurden Allergene genannt. Zu diesen Substanzen gehört beispielsweise Pflanzenpollen, der saisonale Krankheiten namens Heuschnupfen verursacht. Allergene werden in exogene (chemische Substanzen, Nahrungsmittel, verschiedene Pflanzen, Proteinverbindungen, Mikroorganismen usw.) und endogene Allergene unterteilt. Sie sind Produkte der lebenswichtigen Aktivität des zu Allergenen neigenden Organismus und entstehen infolge von Stoffwechselstörungen, dem Auftreten bestimmter Krankheiten oder im Organismus vegetierenden mikrobiellen Assoziationen. Auch chronische Infektionsherde, Seren und Impfstoffe, zahlreiche Medikamente, Haushalts- und Epidermisallergene usw. können eine Allergiequelle sein. Eine besondere Gruppe von Allergenen sind physikalische Faktoren – Hitze, Kälte, mechanische Einwirkungen, die im dafür empfindlichen Organismus die Produktion spezieller Substanzen mit allergenen Eigenschaften verursachen.
Wenn ein Allergen in den Körper gelangt, entwickelt sich eine allergische Reaktion, die je nach Art spezifisch oder unspezifisch sein kann. Eine spezifische Reaktion durchläuft drei Stadien – das immunologische, das Stadium der Mediatorbildung und das pathophysiologische Stadium bzw. die klinischen Manifestationen. Unspezifische allergische Reaktionen (pseudoallergisch, nicht-immunologisch) treten beim ersten Kontakt mit einem Allergen ohne vorherige Sensibilisierung auf. Sie sind nur durch das zweite und dritte Stadium einer allergischen Reaktion gekennzeichnet. Allergische Rhinitis kann sowohl als spezifische als auch als unspezifische Reaktion auftreten und bezieht sich hauptsächlich auf allergische Reaktionen des ersten Typs, zu denen auch anaphylaktischer Schock, Urtikaria, atopisches Asthma bronchiale, Heuschnupfen, Quincke-Ödem usw. gehören.
Neurovegetative Form der vasomotorischen Rhinitis
Diese Form der vasomotorischen Rhinitis ist in der Regel nicht durch Saisonalität gekennzeichnet. Die vasomotorische Rhinitis tritt zu jeder Jahreszeit gleich häufig auf und hängt hauptsächlich von äußeren provozierenden Faktoren (Staubigkeit der Räume, aggressive Dämpfe in der Atemluft, Kontaktkrümmungen der Nasenscheidewand) oder der zuvor erwähnten allgemeinen neurovegetativen Dysfunktion ab. Im letzteren Fall handelt es sich in der Regel nicht nur um Patienten eines Rhinologen, sondern auch eines Neurologen.
Was bedrückt dich?
Diagnose der vasomotorischen Rhinitis
Diagnose der vasomotorischen Rhinitis: Pathologische Veränderungen und klinischer Verlauf der anhaltenden allergischen Rhinitis können in vier Stadien unterteilt werden:
- Stadium vorübergehender aperiodischer Anfälle;
- Typphase fortsetzen;
- Stadium der Polypenbildung;
- Verkarstungsstadium.
Das erste Stadium ist durch einen mehr oder weniger konstanten, mäßigen Schnupfen mit periodischen Anfällen gekennzeichnet. Patienten mit dieser Form der Rhinitis reagieren sehr empfindlich auf Kälte und reagieren auf die geringste Abkühlung der Hände, Füße oder des gesamten Körpers sowie auf Zugluft mit einer Verschlimmerung des pathologischen Prozesses. Die Patienten klagen über ständige, periodisch zunehmende verstopfte Nase, verminderten oder fehlenden Geruchssinn, schlechten Schlaf, Mundtrockenheit, Kopfschmerzen, erhöhte körperliche und geistige Ermüdung sowie periodische Anfälle von Ausatemermüdung. In diesem Stadium treten erste Anzeichen einer beeinträchtigten Durchlässigkeit der Zellmembranen auf.
Bei der vorderen und hinteren Rhinoskopie werden in diesem Stadium der Erkrankung die gleichen Veränderungen beobachtet wie bei einem Anfall von saisonaler Rhinitis, und die Wirkung der abschwellenden Mittel auf die Gefäße der Nasenhöhle bleibt erhalten.
Bei einem längeren Verlauf einer anhaltenden allergischen Rhinitis tritt jedoch ihr zweites Stadium ein, das sich in den ersten Anzeichen einer Degeneration der Nasenschleimhaut manifestiert. Es wird blass, nimmt eine gräuliche Tönung an, ist mit körnigen Formationen bedeckt, die besonders im Bereich der vorderen Enden der mittleren und unteren Nasenmuscheln und des hinteren Endes der unteren Nasenmuscheln auffallen. In diesem Stadium werden die Schwierigkeiten bei der Nasenatmung mehr oder weniger konstant, die Wirkung von Vasokonstriktor-Medikamenten wird auf ein Minimum reduziert, der Geruchssinn fehlt praktisch, allgemeine Beschwerden verstärken sich.
Nach einiger Zeit, berechnet von mehreren Monaten bis zu 1–4 Jahren, erscheinen Schleimpolypen im mittleren Nasengang (Stadium der Polypenbildung oder polypösen Rhinitis) in Form von durchscheinenden sackförmigen Gebilden, die an einem Stiel im Lumen des gemeinsamen Nasengangs hängen. Meistens sehen sie abgeflacht aus, eingeklemmt zwischen der Seitenwand der Nase und ihrem Septum. Alte Polypen sind meist mit einem dünnen Gefäßnetz bedeckt und wachsen in Bindegewebe ein.
Gleichzeitig beginnt das Stadium der Verkarnung: Das Gewebe der mittleren und insbesondere der unteren Nasenmuschel verdichtet sich, reagiert nicht mehr auf Vasokonstriktoren und entwickelt alle Anzeichen einer hypertrophen Rhinitis. Das dritte und vierte Stadium sind durch ständige verstopfte Nase, mechanische und sensorische Anosmie sowie eine Zunahme der allgemeinen Krankheitssymptome gekennzeichnet.
Allgemeine Krankheitssymptome (erhöhte Müdigkeit, Schlaflosigkeit, häufige Erkältungen, Kälteempfindlichkeit usw.) werden konstant. Im Stadium der Polypenbildung verstärken und häufen sich die Anfälle von Asthma bronchiale. Der zeitliche Zusammenhang zwischen Asthma bronchiale und dem Stadium der Polypenbildung kann variieren. Oft tritt das Stadium der Polypenbildung, d. h. das Syndrom der allergischen Rhinitis, als primäre Läsion auf. Wenn die Allergie auf einer nicht-infektiösen Genese beruht, sprechen wir von atopischem Asthma bronchiale. Es ist auch zu beachten, dass sich ähnliche pathomorphologische Prozesse bei allergischer Rhinitis in den Nasennebenhöhlen und am häufigsten in den Kieferhöhlen entwickeln, von denen aus Polypen durch ihre Anastomose in den mittleren Nasengang prolabieren.
Die Behandlung der allergischen Rhinitis umfasst die Verwendung von Antiallergika, Desensibilisierungsmittel, Antihistaminika, Vasokonstriktoren, Lokalanästhetika und allgemeinen Beruhigungsmitteln. Diese Liste von Medikamenten wird von der internationalen Gemeinschaft der Rhinologen in Form des sogenannten Konsenses von 1996 empfohlen. Trotz dieser Empfehlungen und zahlreicher Originalvorschläge verschiedener Autoren bleibt die Behandlung von Patienten mit allergischer Rhinitis eine schwierige und nicht vollständig gelöste Aufgabe. Die wirksamste Methode besteht darin, das Allergen zu identifizieren und zu eliminieren, das die vasomotorische Rhinitis verursacht. Bei einer Polyallergie wird diese Methode jedoch auch unwirksam, zumal diese Form der allergischen Rhinitis nach dem Typ der sogenannten schleichenden Allergie verlaufen kann, wenn zuvor indifferente Substanzen unter dem Einfluss der sensibilisierenden Wirkung von Allergenen selbst zu solchen werden und entsprechende, manchmal hypererge Reaktionen hervorrufen.
Was muss untersucht werden?
Welche Tests werden benötigt?
Wen kann ich kontaktieren?
Behandlung der vasomotorischen Rhinitis
Die Behandlung der vasomotorischen Rhinitis erfolgt überwiegend symptomatisch und zielt auf den Einsatz von Sympathomimetika mit vasokonstriktorischer Wirkung (Sanorin, Naphthyzin, Ephedrin etc.) ab. Zu den Arzneimitteln der neuen Generation gehören Darreichungsformen, deren Wirkstoffe Substanzen mit sympathomimetischen Eigenschaften sind, wie Oxymetazolin (Nazivin, Nazol), Tetrahydrozolinhydrochlorid (Tizin), Xylometazolinhydrochlorid (Xylometazolin, Xymelin) etc. Alle aufgeführten Tropfen gegen Rhinitis wirken alpha-adrenerge, verengen periphere Gefäße, reduzieren Schwellungen der Nasenschleimhaut, Hyperämie und Exsudation. Sie sind indiziert bei akuter neurovegetativer und allergischer Rhinopathie, Heuschnupfen, Sinusitis und deren Komplikationen Tuben- und Mittelohrentzündung. Sie werden in Form von Tropfen und Aerosolen angewendet. Verabreichungsmethoden und Dosierung sind in den entsprechenden Anmerkungen angegeben.
Symptomatische Behandlung der vasomotorischen Rhinitis
Zur symptomatischen Behandlung sollten auch verschiedene chirurgische Eingriffe gehören, wie beispielsweise die mechanische und ultraschallgesteuerte submuköse Zerstörung der Gefäßplexus der unteren Nasenmuscheln zur anschließenden Vernarbung, die Galvanokauteration der unteren Nasenmuscheln, die Verwendung kauterisierender Silbernitratsalze usw.
Elemente der pathogenetischen Behandlung der vasomotorischen Rhinitis umfassen verschiedene physiotherapeutische Methoden, sowohl lokale als auch Fernbehandlungen, die darauf abzielen, die Interaktion der sympathischen und parasympathischen Teile des ANS zu normalisieren, die Mikrozirkulation und enzymatische Aktivität zu verbessern, die Oxidation von Biosubstraten zu verstärken, die Funktion der Zellmembranen zu normalisieren usw. Zu den lokalen Methoden gehören beispielsweise die Verwendung von niederenergetischer Laserstrahlung, konstanten Magnetfeldern usw. Nach der Methode von AF Mamedov (1991) wird eine kombinierte Wirkung dieser Faktoren verwendet, bei der ein konstantes Magnetfeld von außen auf den Nasenhang gerichtet wird und von innen unter Verwendung eines Laserlichtleiters die reflexogenen Zonen der vorderen Enden der mittleren und unteren Nasenmuscheln bestrahlt werden. Aus der Ferne werden eine Laserbestrahlung der Projektionszone des Ganglion pterygopalatinum, verschiedene physiotherapeutische Wirkungen auf die Kragenzone usw. verwendet.
Bei der Behandlung der neurovegetativen Form der vasomotorischen Rhinitis ist eine gezielte Untersuchung des allgemeinen neurovegetativen Status wichtig, um mögliche allgemeine neurologische Störungen und neurotische Zustände zu identifizieren. Bewertet werden Lebens- und Arbeitsbedingungen, das Vorhandensein von schlechten Gewohnheiten, chronischen Infektionsherden und Erkrankungen der inneren Organe.
Alle Behandlungsmethoden für allergische Rhinitis werden in lokale und allgemeine, symptomatische und pathogenetische unterteilt. Wird ein Allergen gefunden und ein entsprechendes Anti-Antigen-Serum produziert, spricht man von einer etiotropen oder immunologischen Behandlung. Derzeit gibt es eine Vielzahl verschiedener Medikamente gegen Allergien, insbesondere gegen allergische Rhinitis. Detaillierte Informationen dazu finden Sie im Arzneimittelregister.
Lokale Behandlung der vasomotorischen Rhinitis
Die lokale Behandlung ist hauptsächlich symptomatisch und nur teilweise pathogenetisch und zielt darauf ab, lokale allergische Reaktionen, d. h. das Nasensyndrom einer allgemeinen Allergie, zu blockieren. Lokale Präparate werden in Form von Nasensprays verwendet, seltener in Form von Tropfen oder Pulver, die in die Nasenhöhle geblasen werden. Als lokale Präparate werden Präparate auf Basis von Azelastinhydrochlorid (Allergodil), Levocabastin usw. verwendet.
Allergodil ist als Nasenspray und Augentropfen erhältlich. Levocabistip wird als endonasale und Augentropfen angewendet. Beide Medikamente wirken antiallergisch und antihistaminisch und blockieren selektiv H1-Rezeptoren. Nach intranasaler Anwendung lindert es schnell die Symptome einer allergischen Rhinitis (Juckreiz in der Nasenhöhle, Niesen, Rhinorrhoe) und verbessert die Nasenatmung durch Verringerung der Schwellung der Nasenschleimhaut. Bei Anwendung auf der Bindehaut lindert es die Symptome einer allergischen Konjunktivitis (Juckreiz, Tränenfluss, Hyperämie und Schwellung der Augenlider, Xsmose). Neben Antihistaminika ist bei allergischer Rhinitis die lokale Anwendung von Alphablockern (Naphthyzin, Sanorin, Galazolin) sowie neuer Medikamente mit ähnlicher Wirkung (Dr. Theiss Nasenspray, Nazivin, Tizin, Ximeyain usw.) möglich.
Jedes Medikament zur Behandlung von Allergien und anderen Erkrankungen ist durch Begriffe wie Kontraindikationen, Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Überdosierung, Vorsichtsmaßnahmen, besondere Hinweise, Verträglichkeit mit anderen Medikamenten usw. gekennzeichnet, die in den entsprechenden Handbüchern, Nachschlagewerken und Anmerkungen detailliert beschrieben sind. Vor der Anwendung eines Medikaments müssen diese Informationen sorgfältig geprüft werden.
Allergodil-Spray: Erwachsene und Kinder über 6 Jahre, 2-mal täglich ein Sprühstoß in jede Nasenhälfte. Augentropfen für Erwachsene und Kinder über 4 Jahre, morgens und abends ein Tropfen, bis die Krankheitssymptome verschwinden.
Levocabastin: intranasal für Erwachsene und Kinder über 6 Jahre – 2 Inhalationen in jeden Nasengang 2-mal täglich (maximal 4-mal täglich). Die Behandlung wird fortgesetzt, bis die Symptome verschwinden.
Dr. Theiss Nasenspray: Das Spray basiert auf Kenlometazolin, das gefäßverengend und blutstillend wirkt. Das Medikament wird mit einem speziellen Sprühgerät in beide Nasenhälften inhaliert, wobei 2 Tage lang 3-4 mal täglich ein Sprühstoß in jede Nasenhälfte erfolgt.
Nazivin (Oximstazolin) ist als Tropfen und Spray erhältlich. Nasentropfen: Erwachsene und Kinder über 6 Jahre, 1-2 Tropfen in jede Nasenhälfte 2-3 mal täglich, 0,05%ige Lösung; Kinder von 1 bis 6 Jahren - 0,025 %, unter 1 Jahr - 0,01%ige Lösung. Nasenspray und dosiertes Nasenspray 0,5%: Erwachsene und Kinder über 6 Jahre - ein Sprühstoß 2-3 mal täglich für 3-5 Tage.
Tizin (Tetrahydrozolinhydrochlorid) ist ein sympathomimetisches Amin. Tropfen, Aerosol, Gel zur intranasalen Anwendung (0,05–0,1 %). Erwachsene und Kinder über 6 Jahre: 2–4 Tropfen in jedes Nasenloch, höchstens alle 3 Stunden. Es hat auch eine beruhigende Wirkung und ist in der Pädiatrie anwendbar.
Ximelin (Kenlometazolin) stimuliert alpha-adrenerge Rezeptoren, hat eine schnelle und lang anhaltende vasokonstriktorische und antikongestive Wirkung. Erwachsene und Kinder über 6 Jahre – 4-mal täglich 2-3 Tropfen einer 1%igen Lösung oder ein Sprühstoß aus einer Sprühflasche in jede Nasenhälfte. Säuglinge und Kinder unter 6 Jahren – 1-2 Tropfen einer 0,5%igen Lösung in jedes Nasenloch 1-2 (höchstens 3) mal täglich. Nasengel nur für Erwachsene und Kinder über 7 Jahre – 3-4 mal täglich; eine kleine Menge mit einem Wattestäbchen so tief wie möglich einige Minuten lang in jede Nasenhälfte einträufeln, damit sich das Wattestäbchen leicht entfernen lässt.
Die lokale Behandlung der allergischen Rhinitis sollte gezielt durch die im Abschnitt zur Behandlung der neurovegetativen Form der vasomotorischen Rhinitis aufgeführten Medikamente ergänzt werden.
Pathogenetische Behandlung der vasomotorischen Rhinitis
Die allgemeine Behandlung sollte als pathogenetisch und in Fällen, in denen immunologische Methoden angewendet werden, auch als etiotrop anerkannt werden. Wie AS Kiselev (2000) feststellt, ist die spezifische Immuntherapie sehr effektiv, ihre Schwierigkeiten liegen jedoch in der Laborisolierung eines aktiven Allergens (Antigens), insbesondere bei Polyallergie. Darüber hinaus kann die Verwendung spezifischer antiallergischer Seren hyperergische Reaktionen wie Anaphylaxie und Verschlimmerung von Asthma bronchiale hervorrufen, sodass sich die Immuntherapie weder in unserem Land noch im Ausland durchgesetzt hat. Die Anwendung einer allgemeinen (oralen) Behandlung basiert auf der Annahme, dass atopische Rhinitis (saisonal, ganzjährig) eine lokale Manifestation einer allgemeinen allergischen Erkrankung ist. Daher ist die Verwendung von Arzneimitteln mit geeigneten pharmakologischen Eigenschaften, die auf den gesamten Körper wirken, eine obligatorische Methode zur Behandlung nicht nur rhinogener Manifestationen einer Allergie, sondern auch ihrer Manifestationen in anderen Organen und Systemen. Die gebräuchlichste Methode zur Anwendung allgemein wirkender antiallergischer Arzneimittel ist die orale Einnahme. Alle von ihnen haben nahezu identische pharmakologische Wirkungen.
Zu den Antihistaminika, die im letzten Jahrhundert breite Anwendung fanden und bis heute nichts von ihrer Relevanz eingebüßt haben, zählen Diphenhydramin, Diazolin, Suprastin und Tavegil, deren wichtigste pharmakodynamische Wirkung darin besteht, endogenes Histamin (die Quelle allergischer Reaktionen) in den Histaminrezeptoren der Blutgefäße zu ersetzen und die pathogenen Eigenschaften des Histamins in diesen Rezeptoren zu blockieren. Derzeit gibt es viele Medikamente der neuen Generation, die wirksamer wirken und keine der für die Medikamente der vorherigen Generation typischen Nebenwirkungen aufweisen. Medikamente der neuen Generation blockieren selektiv H1-Histaminrezeptoren, verhindern die Wirkung von Histamin auf die glatte Muskulatur der Blutgefäße, verringern die Kapillardurchlässigkeit, hemmen die Exsudation und Ausscheidungsfunktion der Drüsen, lindern Juckreiz, Kapillarstase und Erythem, beugen der Entstehung und lindern ihren Verlauf.
Orale Präparate zur Behandlung von vasomotorischer Rhinitis
Astemizol. Indikationen: allergische saisonale und ganzjährige Rhinitis, allergische Konjunktivitis, allergische Hautreaktionen, Angioödem, Asthma bronchiale usw. Art der Anwendung und Dosierung: einmal täglich oral auf nüchternen Magen; Erwachsene und Kinder über 12 Jahre – 10 mg, Kinder von 6–12 Jahren – 5 mg als Tabletten oder Suspension, unter 6 Jahren – 2 mg pro 10 kg Körpergewicht nur als Suspension. Die maximale Behandlungsdauer beträgt 10 Tage.
Loratadin. Die Indikationen sind dieselben wie für Astemizol; darüber hinaus ist es bei allergischen Reaktionen auf Insektenstiche und pseudoallergischen Reaktionen auf Histaminliberatoren angezeigt. Art der Anwendung und Dosierung: oral vor den Mahlzeiten. Erwachsene und Kinder (über 12 Jahre oder mit einem Körpergewicht über 30 kg) – 10 mg (1 Tablette oder 1 Teelöffel Sirup) einmal täglich.
Andere Medikamente mit ähnlicher Wirkung: Histalong, Dimeboi, Clarisens, Clariaze, Claritin, Desloratadin, Cystin, Ebastin, Astafen, Ketotif, Ketotifen, Pseudoephedrin und viele andere.
Steroidmedikamente. Eine allgemeine Steroidtherapie bei allergischer Rhinitis wird äußerst selten angewendet, nur in Fällen, die durch Anfälle von atopischem Asthma bronchiale kompliziert sind, und ist das Vorrecht eines Lungenfacharztes, im Falle eines anaphylaktischen Schocks eines Beatmungsgeräts. Die lokale Anwendung von Kortikosteroiden in Kombination mit einer Antihistaminikatherapie erhöht jedoch die Wirksamkeit der Behandlung von allergischer Rhinitis, insbesondere bei schweren klinischen Formen, erheblich. Im letzten Jahrhundert verbreiteten sich verschiedene Salben und Emulsionen mit Steroidkomponenten. Heutzutage werden modernere Kombinationspräparate verwendet, die nicht die Nebenwirkungen von Steroiden in reiner Form aufweisen. Zu diesen Medikamenten gehören Beconase (Beclometasondipropionat), Syntaris (Flunisolid), Flixonase (Fluticasonpronionat) usw.
Beconase ist ein Dosieraerosol eines Glukokortikoids zur intranasalen Anwendung. Eine Dosis enthält 50 µg des Wirkstoffs Beclomethasondipropionat. Das Medikament hat eine ausgeprägte entzündungshemmende und antiallergische Wirkung und beseitigt Ödeme und Hyperämie. Es dient zur Vorbeugung und Behandlung von saisonaler und ganzjähriger allergischer Rhinitis. Die Anwendung erfolgt ausschließlich intranasal, zwei Inhalationen in jedes Nasenloch < 2-mal täglich. Die maximale Tagesdosis beträgt 8 Inhalationen pro Tag.
Sintaris ist ein Dosieraerosol (Wirkstoff Flusinolid) eines Glukokortikoids zur intranasalen Anwendung. Es ist in 20-ml-Glasflaschen (200 Dosen) mit Dosierspray erhältlich. Es wirkt abschwellend, antiexsudativ und antiallergisch. Es ist angezeigt bei saisonaler und ganzjähriger Rhinitis, einschließlich Heuschnupfen. Erwachsenen werden zweimal täglich zwei Sprühstöße in jedes Nasenloch verschrieben. Bei einer Exazerbation oder schweren Verläufen der Erkrankung dreimal täglich zwei Sprühstöße in beide Nasenhälften. Kindern wird einmal täglich ein Sprühstoß (25 µg) verschrieben. Maximaldosis: Erwachsene 6, Kinder 3 Sprühstöße täglich.
Ähnliche Nasensprays (Flixonase und Flixotide) auf der Basis von Fluticason erzielen die gleiche therapeutische Wirkung wie die genannten; ihre systemische Wirkung ist jedoch minimal.
Derzeit sind Kombinationspräparate, die Substanzen mit antihistaminischer und alpha-adrenomimetischer Wirkung enthalten, wie beispielsweise Clarinase und Rinopront, weit verbreitet.
Clarinase-12 (Zusammensetzung: Tabletten mit 5 mg Loratadin und 120 mg Pseudoephedrin). Sie wirken antiallergisch und gefäßverengend; blockieren H1-Rezeptoren, wirken abschwellend (Pseudoephedrinsulfat), reduzieren Schwellungen der Schleimhäute der oberen Atemwege, verbessern deren Durchgängigkeit und erleichtern die Atmung. Die Einnahme erfolgt oral, unabhängig von der Nahrungsaufnahme, unzerkaut mit einem Glas Wasser. Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: 1-2 mal täglich 1 Tablette.
Wirkstoffe - Carbinoxaminmaleat und Phenylephrinhydrochlorid mit antihistaminischer und antiallergischer Wirkung. Carbinoxamin verringert die Durchlässigkeit der Kapillaren der Nasenschleimhaut, Phenylephrin wirkt sympathomimetisch, verursacht eine Vasokonstriktion und reduziert die Schwellung der Schleimhaut. Innerhalb von 10-12 Stunden beseitigt es die Symptome einer akuten Rhinitis, Brennen und Jucken in den Augen sowie ein Schweregefühl im Kopf. Diese Darreichungsform wird bei akuter Rhinitis unterschiedlicher Genese (vasomotorisch, allergisch, infektiös und entzündlich, Heuschnupfen) angewendet.
Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren wird 2-mal täglich im Abstand von 12 Stunden 1 Kapsel verschrieben. Bei Schluckbeschwerden wird 2-mal täglich 1 Esslöffel Sirup verschrieben. Kinder von 1 bis 6 Jahren - 2-mal täglich 1 Teelöffel Sirup, von 6 bis 12 Jahren - 2-mal täglich 2 Teelöffel.
Die lokale Steroidtherapie ist in Kombination mit Antihistaminika und Alpha-Adrenoblockern wirksam. Kortikosteroide zur lokalen Anwendung sind in der Regel in zusammengesetzten Darreichungsformen enthalten, die nach speziellen Rezepturen hergestellt werden, oder werden in Monoform verwendet.
Zu den Medikamenten der neuesten Generation gehört Rhinocort, dessen Wirkstoff das halbsynthetische Kortikosteroid Budesonid ist.
Rinocort ist ein Glukokortikoid zur Inhalation; es ist als Aerosol erhältlich. Es wirkt lokal entzündungshemmend, praktisch ohne systemische Wirkung. Es ist indiziert bei saisonaler und ganzjähriger allergischer Rhinitis sowie zur Vorbeugung von Heuschnupfen und Polypenrückfällen nach Polypotomie. Die Anfangsdosis beträgt morgens und abends zwei Sprühstöße (100 µg) in jedes Nasenloch. Sobald die therapeutische Wirkung erreicht ist, kann die Dosis reduziert werden.
Weitere Informationen zur Behandlung


 [
[