
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
CAR-T bei Lupus: Ein Durchbruch oder zu früh zum Jubeln?
Zuletzt überprüft: 09.08.2025
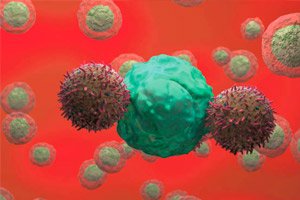
Bei manchen Patienten mit systemischem Lupus erythematodes (SLE) wirken Standardmedikamente nicht oder erleiden einen Rückfall. Die CAR-T-Zelltherapie, die seit langem in der Onkohämatologie eingesetzt wird, zeigte in frühen SLE-Studien sehr starke Reaktionen: Symptome und Laborbefunde ließen schnell nach, und die Patienten konnten teilweise andere Medikamente absetzen. Dies ist jedoch noch Phase I: Das Ziel ist die Sicherheit, nicht der Nachweis einer dauerhaften Heilung.
Warum CAR-T bei SLE?
Bei SLE spielt das Immunsystem verrückt: B-Zellen produzieren Autoantikörper und greifen Gewebe (Gelenke, Haut, Nieren usw.) an. CAR-T trainiert die körpereigenen T-Zellen des Patienten, B-Zellen im gesamten Körper zu erkennen und gründlich zu „reinigen“ – eine „Überlastung“ des Immunsystems in der Hoffnung auf eine langfristige Remission.
Wie sieht es Schritt für Schritt aus?
- Screening: SLE-Aktivität bestätigen, Behandlungsverlauf erfassen.
- Leukapherese: Blut wird entnommen und T-Zellen werden isoliert.
- Genetische Veränderung von T-Zellen im Labor (mehrere Wochen).
- Lymphodepletion: Kurzzeit-Chemotherapie schafft eine „Nische“ für CAR-T.
- Einzelne CAR-T-Infusion + 1–2 Wochen Krankenhausaufenthalt zur Beobachtung.
- Weitere Kontrollen: zunächst häufig (alle paar Wochen), dann seltener; das Immunsystem erholt sich allmählich.
Was sehen sie bereits in frühen Versuchen?
- Schnelle klinische und laborchemische Besserung, auch bei schweren Manifestationen (z. B. Nierenschäden).
- Nach der „Nullsetzung“ kehren die B-Zellen in den „naiven“ Zustand zurück – sie greifen ihr eigenes Gewebe nicht an.
- Einige Patienten brechen die Begleittherapie ab.
Dabei scheint es sich tatsächlich um einen qualitativ anderen Effekt zu handeln als bei herkömmlichen Anti-B-Zell-Medikamenten, die nicht immer zu einer so starken und vollständigen B-Zell-Depletion führen.
Risiken und was schiefgehen kann
CAR-T ist keine harmlose Infusion. Durch die starke Aktivierung des Immunsystems sind folgende Effekte möglich:
- Zytokinsyndrom (CRS): Fieber, Blutdruckabfall;
- Neurophänomene (ICANS): von leichter Verwirrung bis zu Krampfanfällen (selten);
- Infektionen: Die Immunität wird durch die Chemotherapie und CAR-T selbst vorübergehend unterdrückt.
Daher sind eine engmaschige Krankenhauseinweisung und Überwachung durch ein erfahrenes Team erforderlich; die meisten Probleme lassen sich mit unterstützender Pflege in den Griff bekommen.
Wem wird es jetzt angeboten?
Derzeit ist es für Patienten mit schweren Erkrankungen gedacht, bei denen Standardtherapien häufig versagt haben (oftmals mit Nierenbeteiligung). Die meisten Protokolle befinden sich in Phase I (Dosisauswahl/Sicherheit). Anschließend benötigen wir die Phasen II und III an größeren Gruppen, um Folgendes zu verstehen:
- wie lange wird die Remission dauern;
- wem genau es hilft (Auswahlbiomarker);
- ist es möglich und notwendig, Zyklen zu wiederholen;
- wie ist das Kosten-/Verfügbarkeits- und Sicherheitsprofil im „echten Leben“?
Zusammenfassung
CAR-T bei SLE ist ein echter Kandidat für einen Paradigmenwechsel (Remissionen ohne dauerhafte Immunsuppressiva scheinen erreichbar). Es ist jedoch zu früh, von einer „Heilung von Lupus“ zu sprechen: Die Evidenzbasis wird noch gebildet, und die Methode bleibt ohne das richtige Team und die richtige Auswahl komplex, teuer und riskant.
Wenn Sie möchten, kann ich eine Erinnerung für Patienten („Was Sie Ihren Arzt vor CAR-T fragen sollten“) oder eine Kurzversion für Ärzte (Einschlusskriterien, Reaktionsprädiktoren, CRS/ICANS-Überwachung) erstellen.
