
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Syndrome der polyglandulären Insuffizienz
Facharzt des Artikels
Zuletzt überprüft: 04.07.2025
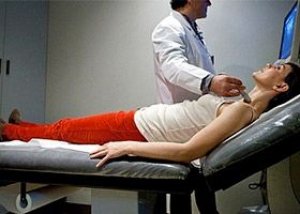
Polyglanduläre Mangelsyndrome (autoimmune polyglanduläre Syndrome; polyendokrine Mangelsyndrome) sind durch die gleichzeitige Funktionsstörung mehrerer endokriner Drüsen gekennzeichnet. Die Ätiologie ist meist unklar. Die Symptome werden durch eine Kombination endokriner Mangelerscheinungen bestimmt, die eine von drei bekannten Krankheitstypen darstellen können. Die Diagnose basiert auf den Ergebnissen hormoneller Untersuchungen und der Bestimmung des Antikörperspiegels gegen die am Krankheitsprozess beteiligten endokrinen Drüsen. Die Behandlung umfasst den Ersatz des verlorenen oder fehlenden Hormons.
Ursachen des polyglandulären Insuffizienzsyndroms.
Die Entwicklung endokriner Defizite kann durch Infektionen, Infarkte oder Tumore verursacht werden, die eine teilweise oder vollständige Zerstörung der endokrinen Drüse verursachen. Auslöser der polyglandulären Insuffizienz ist jedoch eine Autoimmunreaktion, die zur Entwicklung einer Autoimmunentzündung, lymphozytären Infiltration und teilweisen oder vollständigen Zerstörung der endokrinen Drüse führt. Die Beteiligung einer endokrinen Drüse am pathologischen Autoimmunprozess geht fast immer mit der Beteiligung anderer Drüsen einher, was zur Entwicklung multipler endokriner Defizite führt. Drei Modelle neu auftretender Autoimmunerkrankungen werden beschrieben.
Typ I
Die Erkrankung beginnt meist im Kindesalter (vor allem zwischen 3 und 5 Jahren) oder bei Erwachsenen bis 35 Jahre. Hypoparathyreoidismus ist die häufigste endokrine Störung (79 %), gefolgt von Nebenniereninsuffizienz (72 %). Eine Gonadeninsuffizienz entwickelt sich nach der Pubertät bei 60 % der Frauen und etwa 15 % der Männer. Eine chronische mukokutane Candidose ist ein typisches Krankheitsbild. Eine Malabsorption in Verbindung mit Cholezystokininmangel kann auftreten; weitere ätiologische Faktoren sind interstitielle Lymphangiektasien, IgA-Mangel und bakterielle Überwucherung. Obwohl zwei Drittel der Patienten Antikörper gegen Pankreas-Glutaminsäuredecarboxylase haben, ist die Entwicklung eines Typ-1-Diabetes mellitus selten. Auch ektodermale Erkrankungen (z. B. Schmelzhypoplasie, Trommelfellsklerose, tubulointerstitielle Pathologie, Keratokonjunktivitis) können auftreten. Typ I kann sich als erbliches Syndrom entwickeln und wird normalerweise autosomal-rezessiv übertragen.
Typ II (Schmidt-Syndrom)
Multiple endokrine Mängel entwickeln sich normalerweise im Erwachsenenalter, mit einem Höhepunkt im Alter von 30 Jahren. Diese Pathologie ist bei Frauen doppelt so häufig. Die Nebennierenrinde und oft auch die Schilddrüse und die Inselzellen der Bauchspeicheldrüse sind immer an dem pathologischen Prozess beteiligt, dessen Pathologie die Ursache für Typ-1-Diabetes ist. Oft werden Antikörper gegen Zielorgane nachgewiesen, insbesondere gegen das adrenocorticotrope Hormon Cytochrom P450. Es kann ein Mangel sowohl der Mineralokortikoid- als auch der Glukokortikoidfunktionen vorliegen. Die Zerstörung der endokrinen Drüsen entwickelt sich meist als Folge zellulärer Autoimmunreaktionen oder als Folge einer Abnahme der Suppressorfunktion der T-Zellen oder als Folge der Entwicklung anderer Arten von T-Zell-vermittelten Schäden. Ein charakteristisches Zeichen ist eine Abnahme der systemischen T-Zell-vermittelten Immunität, die sich in negativen Ergebnissen intradermaler Tests auf Standardantigene manifestiert. Bei Verwandten ersten Grades ist die Reaktionsfähigkeit ebenfalls um etwa 30 % reduziert, bei normaler endokriner Funktion.
Bei einigen Patienten werden Schilddrüsen-stimulierende Antikörper nachgewiesen und sie weisen zunächst klinische Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion auf.
Theoretisch könnten bestimmte HLA-Typen eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Viren aufweisen, was eine Autoimmunreaktion auslösen kann. Die Krankheit wird in der Regel autosomal-dominant vererbt, mit variabler Ausprägung.
Kranker Typ
Typ III ist durch endokrine Störungen gekennzeichnet, die bei Erwachsenen, insbesondere bei Frauen mittleren Alters, auftreten. In diesem Fall ist die Nebennierenrinde nicht an der Pathologie beteiligt, es entwickeln sich jedoch mindestens zwei der folgenden Pathologien: Schilddrüsenfunktionsstörung, Typ-1-Diabetes, perniziöse Anämie, Vitiligo und Alopezie. Die Vererbung kann autosomal-dominant mit partieller Penetranz sein.
Symptome des polyglandulären Insuffizienzsyndroms.
Die klinischen Manifestationen des polyendokrinen Mangelsyndroms bei Patienten bestehen aus der Summe der Symptome einzelner endokriner Erkrankungen. Bei diesen Syndromen gibt es keine so spezifischen klinischen Symptome wie bei einer einzelnen endokrinen Pathologie. Daher sollte bei Patienten mit einer diagnostizierten endokrinen Erkrankung nach einer gewissen Zeit ein Screening (klinische Untersuchung und Labordiagnostik) auf das Vorhandensein zusätzlicher endokriner Mängel durchgeführt werden. Angehörige von Patienten mit dieser Pathologie sollten über die Diagnose informiert sein, und es wird ihnen dringend empfohlen, sich einer ärztlich verordneten Vorsorgeuntersuchung zu unterziehen. Die Messung der Antikörperspiegel gegen Glutaminsäuredecarboxylase kann helfen, das Risiko für die Entwicklung einer Pathologie zu bestimmen.
Diagnose des polyglandulären Insuffizienzsyndroms.
Die Diagnose wird klinisch gestellt und durch den Nachweis eines Hormonmangels im Labor bestätigt. Die Messung von Autoantikörpern gegen das am pathologischen Prozess beteiligte endokrine Drüsengewebe kann helfen, das autoimmune endokrine Syndrom von anderen Ursachen intraorganischer Pathologie (z. B. Nebennierenunterfunktion tuberkulöser Ätiologie, nicht-autoimmune Hypothyreose) zu unterscheiden.
Das polyendokrine Mangelsyndrom kann auf eine Erkrankung der Hypothalamus-Hypophysen-Zone hinweisen. Erhöhte Plasmaspiegel der drei Hypophysenhormone deuten in fast allen Fällen auf eine periphere Natur des sich entwickelnden Defekts hin; eine Hypothalamus-Hypophysen-Insuffizienz entwickelt sich jedoch manchmal im Rahmen eines polyendokrinen Mangelsyndroms Typ II.
Bei Risikopatienten ohne klinische Manifestationen des Syndroms sollte auf das Vorhandensein von Autoantikörpern getestet werden, da diese Antikörper über einen langen Zeitraum im Blut zirkulieren können, ohne endokrine Pathologien zu verursachen.
Wen kann ich kontaktieren?
Behandlung des polyglandulären Insuffizienzsyndroms.
Die Behandlung verschiedener endokriner Pathologien, die sich in bestimmten endokrinen Organen entwickeln, wurde in den entsprechenden Kapiteln dieses Leitfadens erörtert. Das Vorhandensein von Anzeichen einer multiplen endokrinen Organpathologie im klinischen Bild kann die Behandlung erschweren.
Chronische Candidose der Haut und Schleimhäute erfordert in der Regel eine langfristige antimykotische Therapie. Die Gabe von immunsuppressiven Dosen von Ciclosporin im Frühstadium endokriner Erkrankungen (innerhalb der ersten Wochen oder Monate) kann eine erfolgreiche Behandlung ermöglichen.
IPEX-Syndrom
IPEX (Immunerkrankungen, Polyendokrinopathie, Enteropathie, Syndrom, X-chromosomal) ist ein autosomal-rezessiv vererbtes Syndrom, das durch eine ausgeprägte Immun-Autoaggression gekennzeichnet ist.
Unbehandelt verläuft das IPEX-Syndrom meist innerhalb des ersten Lebensjahres nach der Diagnose tödlich. Eine Enteropathie führt zu Durchfall. Immunsuppressive Therapie und Knochenmarktransplantation können das Leben verlängern, das Syndrom ist jedoch unheilbar.
POEMS-Syndrom
POEMS (Polyneuropathie, Organomegalie, Endokrinopathie, monoklonale Gammopathie, Hautveränderungen, Crowe-Fukase-Syndrom) ist ein nicht-autoimmunes polyendokrines Mangelsyndrom.
Das POEMS-Syndrom ist vermutlich auf zirkulierende Immunglobuline zurückzuführen, die von abnormen Plasmazellaggregaten produziert werden. Patienten können Hepatomegalie, Lymphadenopathie, Hypogonadismus, Typ-2-Diabetes mellitus, primäre Hypothyreose, Hyperparathyreoidismus, Nebenniereninsuffizienz und erhöhte monoklonale IgA- und IgG-Spiegel bei Myelom sowie Hautanomalien (z. B. Hauthyperpigmentierung, Hautverdickung, Hirsutismus, Angiome, Hypertrichose) entwickeln. Patienten können Ödeme, Aszites, Pleuraerguss, Papillenödem und Fieber aufweisen. Patienten mit diesem Syndrom können auch erhöhte zirkulierende Zytokine (IL1p, IL6), vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor und Tumornekrosefaktor-α aufweisen.
Die Behandlung erfolgt durch autologe hämatopoetische Stammzelltransplantation, gefolgt von Chemotherapie und Strahlentherapie. Die Fünfjahresüberlebensrate liegt bei dieser Erkrankung bei etwa 60 %.


 [
[