
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Stammzellen gegen Down-Syndrom und Alzheimer: Gemeinsame Ziele und personalisierte Ansätze
Zuletzt überprüft: 09.08.2025
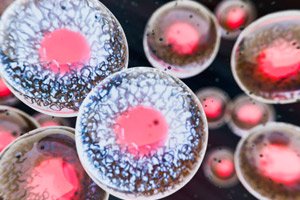 ">
">Wissenschaftler der Tohoku Medical Megabank Organization an der Tohoku University (Japan) haben in der Zeitschrift Stem Cell Research & Therapy eine umfassende Übersicht über aktuelle und vielversprechende Stammzellansätze zur Behandlung des Down-Syndroms (DS) und der Alzheimer-Krankheit (AD) veröffentlicht. Trotz ihrer unterschiedlichen Ätiologien – Trisomie 21 bei DS und altersabhängige Ansammlung von β-Amyloid und Tau-Pathologie bei AD – sind beide Krankheiten durch ähnliche Mechanismen der Neuroinflammation, des oxidativen Stresses und des Verlusts synaptischer Verbindungen gekennzeichnet, was sie zu potenziellen Zielen für Zelltherapien macht.
Quellen von Stammzellen und ihr Potenzial
Neurale Stammzellen (NSCs). Sie sind in der Lage, sich in neue Neuronen und Astrozyten zu differenzieren. In präklinischen Modellen von Diabetes und AD führte die NSC-Transplantation zu
- Wiederherstellung der Anzahl der Neuronen im Hippocampus,
- Verbesserung des Lernens und des Gedächtnisses (Verbesserung der Leistung bei Labyrinthtests),
- Senkung des Spiegels proinflammatorischer Zytokine (TNF-α, IL-1β) um 40–60 %.
Mesenchymale Stammzellen (MSCs). Durch die Sekretion von trophischen Faktoren (BDNF, GDNF) und Exosomen reduzieren sie Neuroinflammationen und stimulieren die endogene Neurogenese. In Modellen von Alzheimer-Patienten bestätigten sie
- Reduktion der Amyloid-Plaques um 30–50 %,
- Wiederherstellung der synaptischen Dichte (PSD95, Synaptophysin).
Induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs). Sie werden aus Zellen von Patienten mit Diabetes oder Alzheimer gewonnen und ermöglichen die maßgeschneiderte Modellierung von Krankheiten, das Testen therapeutischer Interventionen und möglicherweise die Schaffung autokompatibler Transplantate.
Embryonale Stammzellen (ESCs): Aufgrund ihrer höchsten Plastizität bleiben sie eine wichtige Quelle für die Grundlagenforschung, obwohl ihre klinische Verwendung durch ethische Standards eingeschränkt ist.
Allgemeine therapeutische Mechanismen
- Anti-amyloidogene Aktivität. MSC- und NSC-Zellen stimulieren Mikroglia und Astrozyten, β-Amyloid aufzunehmen und so dessen Entfernung aus dem Parenchym zu beschleunigen.
- Modulation der Neuroinflammation. Von MSCs sezernierte Faktoren reduzieren die NLRP3-Inflammasom-Aktivierung und unterdrücken die Migration proinflammatorischer Astrozyten (A1-Phänotyp).
- Stimulation der endogenen Neurogenese. NSC und Wachstumsfaktoren aus MSC aktivieren Reserveneuronenvorläuferzellen in der subventrikulären Zone und im Hippocampus.
- Antioxidative Wirkung. MSC-Exosomen tragen miRNA und Proteine, die die Expression antioxidativer Gene (NRF2, SOD2) erhöhen.
Phasen der klinischen Entwicklung
Alzheimer-Krankheit.
Derzeit laufen klinische Studien der frühen Phase I/II mit MSC und NSC. Dabei wurde bereits Folgendes festgestellt:
- eine Tendenz zur Verbesserung der kognitiven Tests MMSE und ADAS-Cog um 10–15 % nach 6 Monaten,
- Verringerung des p-Tau- und β-Amyloid-Spiegels in der Zerebrospinalflüssigkeit.
Down-Syndrom.
- Bisher beschränkten sich die Untersuchungen auf präklinische Studien an Mausmodellen, bei denen transplantierte NSCs die kognitive Leistung verbessern und die Mikrogliahyperplasie reduzieren.
- Die ersten klinischen Pilotstudien zur MSC-Verabreichung sind geplant, um die Sicherheit und die Auswirkungen auf neurologische Funktionen zu bewerten.
Wichtige Herausforderungen und zukünftige Richtungen
- Ethische und regulatorische Fragen bei der Verwendung von ESC und iPSC.
- Risiko von Tumoren und Immunabstoßung, insbesondere bei ESC.
- Standardisierung der Protokolle: Dosierung, Verabreichungsweg (intrazerebral, intrathekal), optimaler Interventionszeitpunkt.
- Personalisierung der Therapie: Kombination der genetischen Informationen des Patienten (z. B. APOE-Genotyp bei AD) und des Stammzelltyps für maximale Wirksamkeit.
- Kombinationsansätze: Kombination von Zelltransplantationen mit β-Amyloid-Impfung oder τ-Proteinkinase-Inhibitoren.
Die Studie unterstreicht, dass sich Down-Syndrom und Alzheimer zwar in ihren Ursachen unterscheiden, ihre neurodegenerativen Mechanismen sich jedoch überschneiden und Stammzellen sich als vielseitiges Instrument zu deren Modulation erweisen. „Der Übergang von der präklinischen zur klinischen Phase erfordert konzertierte Anstrengungen von Neurowissenschaftlern, Genetikern und Ethikern“, schlussfolgern die Autoren. „Aber das Potenzial, den Verlauf dieser Krankheiten zu verändern, ist enorm.“
