
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Untersuchung des neuropsychischen Bereichs
Facharzt des Artikels
Zuletzt überprüft: 04.07.2025
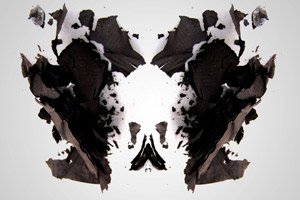
Eine umfassende Untersuchung des neuropsychiatrischen Status des Patienten kann nur durchgeführt werden, wenn der Arzt über ausgezeichnete Kenntnisse der Symptomatologie von Nerven- und Geisteskrankheiten verfügt und die speziellen Untersuchungsmethoden der Neurologie und Psychiatrie beherrscht.
Die Beurteilung des psychischen Zustands eines Patienten beginnt traditionell mit der Einschätzung, wie gut er mit Raum, Zeit und seiner eigenen Persönlichkeit zurechtkommt. In der Regel genügt es, ein paar klärende Fragen zu stellen: „Wo befinden Sie sich gerade?“, „Welcher Wochentag, Monat, Jahr ist heute?“, „Bitte geben Sie Ihren Nachnamen, Vornamen und Vatersnamen an“, „Wo arbeiten Sie?“ usw. Gleichzeitig wird geprüft, ob der Patient kontaktfreudig ist und bereitwillig mit dem Arzt kommuniziert.
Anschließend untersuchen sie den kognitiven, emotionalen und motorisch-volitionalen Bereich. Sie achten auf mögliche Wahrnehmungsstörungen (insbesondere Halluzinationen), die sich beispielsweise darin äußern können, dass der Patient allein auf der Station ist, aktiv gestikuliert, ein lebhaftes Gespräch mit „Stimmen“ führt und sich manchmal die Ohren zuhält, wenn die „Stimmen“ ihm unangenehme Informationen mitteilen usw.
Befragung und Gespräch
Im Gespräch mit dem Patienten wird zudem festgestellt, ob seine Aufmerksamkeit beeinträchtigt ist und ob der Patient sich über längere Zeit auf eine Aufgabe konzentrieren kann. Mögliche Gedächtnisstörungen (für entfernte oder aktuelle Ereignisse) werden notiert.
Bei der Befragung eines Patienten kann man anhand der Merkmale der erhaltenen Antworten Rückschlüsse auf seinen intellektuellen Zustand ziehen, insbesondere auf die Übereinstimmung des Intellekts des Patienten mit seiner Ausbildung. Es wird auf das Vorhandensein oder Fehlen verschiedener Denkstörungen geachtet, die sich in Wahninterpretationen, dem Auftreten überbewerteter Ideen und Zwangszuständen äußern können.
Die Untersuchung der emotionalen Sphäre des Patienten wird durch die Beurteilung seines Aussehens, seiner Kleidung und seines Gesichtsausdrucks unterstützt. So drückt das Gesicht von Patienten in einem depressiven Zustand meist Melancholie und Traurigkeit aus. Bei emotionaler Mattheit werden Patienten sehr schlampig und gleichgültig gegenüber allem. Bei einem manischen Zustand drücken Patienten mit ihrem gesamten Erscheinungsbild eine gehobene Stimmung, Begeisterung und unbändige Freude aus.
Schließlich achten sie bei der Untersuchung der freiwilligen oder willentlichen Aktivität des Patienten auf die Merkmale seines Verhaltens und stellen fest, wie der Patient (selbstständig oder unter Zwang des Personals) bestimmte Handlungen (einschließlich Waschen, Essen usw.) ausführt, ob die Handlungen negativ sind (wenn der Patient das Gegenteil von dem tut, was von ihm verlangt wird), ob normale Triebe verletzt werden (Stärkung, Schwächung usw.).
Bei der Identifizierung möglicher neurologischer Beschwerden wird zunächst auf Kopfschmerzen geachtet, die häufig auftreten können, auch bei Patienten mit somatischen Erkrankungen (Bluthochdruck, Fieber, Vergiftungen usw.). Die Klassifizierung von Kopfschmerzen ist recht komplex und beinhaltet die Identifizierung verschiedener Arten von Cephalgien, d. h. Kopfschmerzen (Wanderungs-, Gefäßkopfschmerzen usw.).
Die Aufgabe des Therapeuten bei der Analyse von Beschwerden wie Kopfschmerzen besteht darin, deren Art (schmerzend, pulsierend, drückend), Lokalisation (im Hinterkopfbereich, Schläfenbereich, in Form eines „Reifens“ usw.) zu klären, herauszufinden, ob die Kopfschmerzen dauerhaft sind oder in Schüben auftreten, ob sie von der Jahreszeit, dem Tag, psychoemotionalen Faktoren oder körperlicher Belastung abhängen, und auch festzustellen, welche Medikamente (Analgetika, krampflösende Mittel usw.) helfen, sie zu lindern.
Wenn der Patient über Schwindel klagt, versucht er herauszufinden, wie oft dieser auftritt, ob er kurzzeitig (Minuten, Stunden) oder langfristig ist, ob er von Übelkeit und Erbrechen begleitet wird und welche Faktoren ihn verursachen (erhöhter Blutdruck, Reisen mit Verkehrsmitteln, Klettern in große Höhen usw.). Es ist zu beachten, dass nicht-systemischer Schwindel (ein Gefühl diffuser Störung der räumlichen Wahrnehmung) häufig bei Anämie, Aortenfehlern des Herzens, Bluthochdruck, Neurosen usw. beobachtet wird, während systemischer Schwindel (mit einem Gefühl der Drehbewegung umgebender Objekte oder des Patienten selbst in eine bestimmte Richtung) normalerweise mit einer Schädigung des Labyrinths oder des Kleinhirns verbunden ist.
Bei der Befragung von Patienten wird auch angegeben, ob Ohnmachtsanfälle auftreten, die häufigste Form kurzfristiger Bewusstlosigkeit. Ohnmachtsanfälle reflexartigen, neurogenen Ursprungs können bei längerem bewegungslosem Stehen oder einem abrupten Übergang von der horizontalen in die vertikale Position auftreten. Ohnmachtsanfälle im Zusammenhang mit der Entwicklung einer zerebralen Ischämie treten bei Herzrhythmusstörungen (Morgagni-Adams-Stokes-Syndrom), Aortenherzfehlern, arterieller Hypertonie, Anämie usw. auf.
Bei der Befragung des Patienten werden auch Art und Dauer seines Schlafs sowie sein Gesundheitszustand nach dem Aufwachen ermittelt. Bei Patienten mit verschiedenen Erkrankungen (auch therapeutischen) treten häufig verschiedene Schlafstörungen auf, darunter Einschlafschwierigkeiten, wiederholtes Aufwachen mitten in der Nacht, frühes Aufwachen am Morgen, Müdigkeit und Erschöpfung nach dem Schlafen, quälende Träume, krankhafte Schläfrigkeit usw.
Schlafstörungen sind sehr typisch für neurotische Zustände, können aber auch bei verschiedenen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Atmungs- und Verdauungsorgane auftreten, insbesondere wenn sie mit starken Schmerzen, starker Atemnot usw. einhergehen. Pathologische Schläfrigkeit wird bei verschiedenen endogenen Intoxikationen beobachtet (z. B. bei chronischer Nieren- und Leberinsuffizienz, Diabetes mellitus), kann aber auch bei Fettleibigkeit, Müdigkeit und Vitaminmangel auftreten.
Eine detaillierte Untersuchung aller 12 Hirnnervenpaare wird von einem Facharzt für Neurologie durchgeführt. Ein Therapeut sollte jedoch auch in der Lage sein, die offensichtlichsten Symptome zu erkennen, die auf eine mögliche Schädigung der Hirnnerven hinweisen. Hierzu zählen insbesondere Beschwerden über Riechstörungen, verminderte Sehschärfe, zentrale und periphere Sehstörungen, Störungen der Pupillenreaktion auf Licht, Akkommodation und Konvergenz, ungleiche Pupillengrößen (Anisokorie), Funktionsstörungen der Kau- und Gesichtsmuskulatur (insbesondere Glättung der Nasolabialfalte, Verzerrung des Mundes), Hörverlust, Gleichgewichtsstörungen und Instabilität in der Romberg-Pose (im Stehen mit geschlossenen Augen, Zusammenführen der Zehen und Fersen), Schluckstörungen, Aphonie (Stimmverlust), Zungenprotrusionsstörungen usw.
Verschiedene Störungen der motorischen Sphäre können in einer Einschränkung oder einem völligen Fehlen aktiver Bewegungen, einer Einschränkung oder umgekehrt einem Übermaß passiver Bewegungen, einer Verletzung der Bewegungskoordination, einer Zunahme oder Abnahme des Muskeltonus und dem Auftreten heftiger Bewegungen bestehen.
Ein wichtiger Abschnitt der neurologischen Untersuchung ist die Beurteilung derReflexsphäre. Bei verschiedenen Erkrankungen des Nervensystems kommt es zu einer Zunahme oder Abnahme der Sehnenreflexe (Knie, Achillessehne usw.), einer Abnahme der Hautreflexe und dem Auftreten pathologischer Reflexe (Babinsky, Rossolimo usw.).
Es gibt spezielle Techniken zur Erkennung von Veränderungender Schmerz- und Temperaturempfindlichkeit. Gleichzeitig können die Patienten selbst über eine verminderte oder völlige Abwesenheit der Empfindlichkeit in verschiedenen Bereichen, das Auftreten von Bereichen mit erhöhter Empfindlichkeit und verschiedene Parästhesien (Krabbelgefühl, Spannungsgefühl, Kribbeln usw.) klagen. Die oben genannten Störungen treten bei Polyneuritis (z. B. bei Patienten mit chronischem Alkoholismus) und Neuropathien auf.
Bei der Befragung achten sie auf mögliche Beckenstörungen (Urinieren, Stuhlgang, Sexualfunktionen), die in einigen Fällen neurogenen Ursprungs sind. Sie achten auf Sprach- und Schreibstörungen, die sich in Artikulationsstörungen (Dysarthrie), Verlust der Lese- (Alexie) und Schreibfähigkeit (Agraphie) usw. äußern können.
Zur Beurteilung des Zustands des autonomen Nervensystems wird der Dermographismus eingesetzt. Dabei werden mit dem Ende eines Glasstabes leichte Reizungen auf die Haut ausgeübt. Normalerweise erscheint bei gesunden Menschen sofort ein weißer Streifen auf der Haut, der mit einem Kapillarspasmus einhergeht. Bei stärkerem Druck bildet sich aufgrund der Erweiterung der Kapillaren ein roter Streifen (roter instabiler Dermographismus). Ein langfristiger (anhaltender) roter Dermographismus, der in solchen Fällen auftritt, deutet auf eine Abnahme des Kapillartonus und deren Erweiterung hin. Im Gegensatz dazu deutet ein langfristiger weißer Dermographismus auf einen anhaltenden Kapillarspasmus hin.


 [
[