
Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Diffuse Veränderungen des Prostataparenchyms: Anzeichen, Behandlung
Facharzt des Artikels
Zuletzt überprüft: 12.07.2025
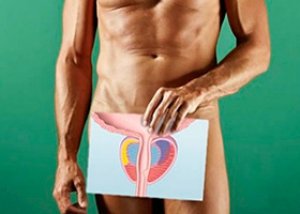
Krankhafte Erkrankungen des Prostatagewebes können nur durch die Darstellung im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung erkannt werden und sind als diffuse Veränderungen der Vorsteherdrüse definiert.
Basierend auf der Art dieser Veränderungen und unter Berücksichtigung der vorhandenen Symptome wird eine bestimmte Erkrankung des männlichen Urogenitalsystems diagnostiziert.
Epidemiologie
Nach Angaben der amerikanischen National Institutes of Health sind 5 bis 10 Prozent der Männer von einer Prostatitis betroffen, bei 10 bis 20 Prozent der Patienten wird eine Zyste – oft als Folge einer Entzündung der Prostatadrüse – festgestellt.
Nach Angaben der Europäischen Gesellschaft für Urologie weisen etwa 25 % der Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren diffuse Veränderungen der Prostata mit Verkalkung auf. Anderen Daten zufolge sind Verkalkungen bei fast 75 % der Männer mittleren Alters sowie bei 10 % der Patienten mit benigner Prostatahyperplasie (Adenom) vorhanden. Diese Erkrankung wird im Alter zwischen 30 und 40 Jahren bei einem von 12 Patienten diagnostiziert; bei etwa einem Viertel der 50- bis 60-Jährigen und bei drei von zehn Männern über 65 bis 70 Jahren. Bei 40 bis 50 % der Patienten wird das Adenom klinisch signifikant.
Das Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken, bedroht 14 % der männlichen Bevölkerung. In 60 % der Fälle wird bei Männern über 65 Jahren eine Onkologie festgestellt, selten bei Männern unter 40 Jahren. Das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Diagnose von Prostatakrebs liegt bei etwa 66 Jahren.
Ursachen diffuse Veränderungen an der Prostata
Die Hauptursachen für diffuse Veränderungen der Prostata führen Urologen auf langfristige Entzündungsprozesse im Prostataparenchym zurück, die durch urogenitale Infektionen (Chlamydien, Gonokokken, Ureaplasma, Trichomonas usw.) verursacht werden.
Die Entwicklung diffuser Veränderungen im Drüsen-, Binde- oder Muskelgewebe der Prostata ist auch verbunden mit:
- Störungen des intrazellulären Stoffwechsels;
- Verschlechterung der Durchblutung der Prostata und des Trophismus ihres Gewebes;
- Ersatz von Drüsengewebe durch faseriges Gewebe im Zuge der altersbedingten Involution der Drüse mit der Entwicklung einer Prostatasklerose;
- bösartige Neubildungen und Metastasen in der Prostata.
Verkalkungen während der Degeneration des Prostatagewebes mit der Bildung verkalkter (verkalkter) Bereiche darin werden durch Ultraschallergebnisse als diffuse Veränderungen in der Prostatadrüse mit Verkalkungen bestimmt. Und bei der Visualisierung von Zysten, die aufgrund erhöhter Sekretproduktion und deren Stagnation gebildet wurden, stellen Ultraschalldiagnostiker diffuse fokale Veränderungen in der Prostatadrüse fest.
Es gibt folgende Arten von morphologischen diffusen Veränderungen in der Prostata:
- Atrophie – eine begrenzte oder weit verbreitete Abnahme der Zellzahl und des Volumens der Drüse mit einer Abnahme ihrer sekretorischen und kontraktilen Funktionen;
- Hyperplasie – eine Zunahme der Gesamtzahl der Zellen aufgrund ihrer Proliferation;
- Dysplasie – abnorme Gewebeveränderung mit Störung des Zellphänotyps.
Atrophische Prozesse treten über einen längeren Zeitraum auf und können als diffus heterogene Veränderungen der Prostata auftreten.
Die benigne Prostatahyperplasie oder das Prostataadenom ist eine altersbedingte Erkrankung, bei der die Anzahl der Stroma- und Epithelzellen zunimmt, was zur Bildung großer isolierter Knoten führt, die meist in der Nähe der Harnröhre lokalisiert sind. Dies kann in der Beschreibung des Ultraschallbildes als diffuse knotige Veränderungen in der Prostata definiert werden. Weitere Details finden Sie in der Publikation - Ursachen und Pathogenese des Prostataadenoms
Als ungünstigste Variante gilt die Dysplasie, und solche diffusen Veränderungen in der Struktur der Prostata werden – je nach Grad und Stadium der Veränderungen auf Zellebene – in leichte, mittelschwere und schwere Formen unterteilt. Die ersten beiden Typen weisen in der Regel auf einen langfristigen Entzündungsprozess hin – die chronische Prostatitis, die mit einer Gewebeschwellung einhergeht und zu einem Abszess führen kann, sich aber unter Therapie auch zurückbilden kann. Eine signifikante Veränderung der Prostatazellen wird von Onkologen jedoch als Vorbote der Entwicklung eines Basalzellkarzinoms oder eines Adenokarzinoms der Prostata angesehen.
Risikofaktoren
Zu den Risikofaktoren für diffuse Veränderungen der Prostata zählen urogenitale Infektionen, die Entzündungen verursachen; Hodenverletzungen; Alkoholmissbrauch; parasitäre Erkrankungen; Schilddrüsen- und Hypophysenerkrankungen; Chemotherapie und Strahlentherapie bei Onkologie jeglicher Lokalisation; die Einnahme bestimmter pharmakologischer Medikamente (Anticholinergika, Entstauungsmittel, Kalziumkanalblocker, trizyklische Antidepressiva).
Es gibt Hinweise darauf, dass Prostatahyperplasie mit dem metabolischen Syndrom in Zusammenhang steht: Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes, hohe Triglycerid- und Low-Density-Cholesterinwerte im Blut sowie arterielle Hypertonie.
Experten zufolge ist der Hauptrisikofaktor jedoch das Alter und die damit verbundene Hodenatrophie sowie der verringerte Testosteronspiegel, das männliche Sexualhormon, das in den Hoden produziert wird. Der altersbedingte Rückgang der Testosteronproduktion beginnt ab dem 40. Lebensjahr und beträgt etwa 1–1,5 % pro Jahr.
 [ 15 ]
[ 15 ]
Pathogenese
Die Pathogenese diffuser Veränderungen der Prostata bei Prostatitis wird durch die Infiltration des Prostatagewebes durch Lymphozyten, Plasmazellen, Makrophagen und Produkte des entzündlichen Gewebezerfalls verursacht. Und das eitrige Schmelzen von Bereichen entzündeten Drüsengewebes führt zur Bildung von mit nekrotischen Massen gefüllten Hohlräumen und deren anschließender Vernarbung, d. h. zum Ersatz von normalem Gewebe durch fibröses Gewebe.
Die Prostata ist ein Organ, das von androgenen Steroiden abhängig ist. Mit zunehmendem Alter nimmt die Aktivität der Enzyme Aromatase und 5-Alpha-Reduktase zu, wodurch Androgene in Östrogen und Dihydrotestosteron (DHT, wirksamer als sein Vorgänger Testosteron) umgewandelt werden. Der Hormonstoffwechsel führt zu einem Rückgang des Testosteronspiegels, erhöht jedoch den Gehalt an DHT und Östrogen, die eine Schlüsselrolle beim Wachstum von Prostatazellen spielen.
Bei älteren Männern ist die Pathogenese diffuser Veränderungen im Parenchym der Prostata mit dem Ersatz von Drüsengewebe durch Bindegewebe unter Bildung einzelner und mehrerer Faserknoten sowie mit einer pathologischen Proliferation des Stromas der Prostata-Azini verbunden.
Diffuse Veränderungen der Prostatadrüse mit Verkalkung treten aufgrund von Gewebedegeneration und Ablagerung unlöslicher Faserproteine (Kollagene) und sulfatierter Glykosaminoglykane auf. Verkalkung kann sich auch durch Sedimentation von Prostatasekret im Parenchym bilden. Verkalkung tritt bei einem Drittel der Fälle einer atypischen adenomatösen Hyperplasie und bei 52 % der Fälle eines Prostataadenokarzinoms auf. Ein späteres Stadium der Verkalkung ist die Bildung von Steinen, die bei gesunden Männern asymptomatisch auftreten können.
Diffuse fokale Veränderungen in der Prostatadrüse mit Zysten werden zufällig entdeckt und laut Urologen ist der Mechanismus ihres Auftretens mit einer Atrophie der Prostatadrüse, ihrer Entzündung, einer Verstopfung des Ejakulationsgangs und einer Neoplasie verbunden.
Symptome diffuse Veränderungen an der Prostata
Experten zufolge ist zu beachten, dass sich die Symptome diffuser Veränderungen der Prostata nur als Symptome der Erkrankungen manifestieren können, bei denen sie bei einer Ultraschalluntersuchung festgestellt wurden.
Die ersten Anzeichen einer Prostatitis, bei der Ultraschall mäßige, diffuse Veränderungen der Prostata erkennen kann, sind in den meisten Fällen Schüttelfrost und häufigeres Wasserlassen. Sehr schnell wird das Wasserlassen schmerzhaft – mit einem brennenden oder stechenden Gefühl; die Patienten müssen nachts auf die Toilette, und die Schmerzen beginnen, die Leisten-, Lenden- und Schamgegend zu beeinträchtigen. Häufige Symptome sind allgemeine Schwäche, erhöhte Müdigkeit sowie Gelenkschmerzen und Myalgie.
Bei diffusen Veränderungen im Parenchym der Prostatadrüse, die mit Prostataadenom assoziiert sind, ist vor allem auch das Wasserlassen beeinträchtigt: Der Harndrang wird häufiger (auch nachts), trotz erheblicher Anspannung der Bauchmuskulatur, der Urin wird erschwert ausgeschieden (die Abnahme des Miktionsdrucks wirkt sich auf den Blasenmuskel aus), und der Prozess der Urinausscheidung selbst bringt nicht die erwartete Erleichterung. Ein nicht weniger unangenehmes Symptom ist Enuresis.
Laut Ärzten verursachen diffuse Veränderungen der Prostata mit Verkalkung in der Regel keine Symptome, und viele wissen nicht einmal von ihrer Existenz. Steine können problematisch werden und zu einer Prostatitis führen, wenn sie als Quelle wiederkehrender Entzündungen dienen. Selbst wenn der Patient Antibiotika einnimmt, bleibt die Verstopfung der Gänge in der Drüse bestehen, wodurch der Entzündungsprozess anhält und zum Auftreten von Prostatitis-Symptomen führen kann.
 [ 19 ]
[ 19 ]
Wo tut es weh?
Komplikationen und Konsequenzen
Alle oben genannten Erkrankungen mit diffusen Veränderungen der Prostata können folgende Folgen und Komplikationen haben:
- chronische Ischurie (Harnverhalt);
- Blasenentzündung und/oder Pyelonephritis;
- Abszess mit dem Risiko einer Sepsis;
- Fistelbildung;
- Ausstülpung der Blasenwand (Divertikel);
- Urolithiasis;
- Atrophie des Nierenparenchyms und deren chronisches Versagen;
- Probleme mit der Erektion.
Diagnose diffuse Veränderungen an der Prostata
Die Diagnose diffuser Veränderungen der Prostata besteht im Wesentlichen in der Identifizierung pathologisch veränderter Gewebe mittels transrektaler Ultraschalluntersuchung, die eine Beurteilung der Struktur und Größe dieses Organs sowie der Homogenität/Heterogenität, Dichte und des Gefäßversorgungsgrads ermöglicht.
Eine korrekte Diagnose von Prostataerkrankungen ist ohne eine visuelle Darstellung des Zustands des Gewebes nicht möglich. Dieser wird auf Grundlage der unterschiedlichen akustischen Dichte (Echogenität) bestimmt – dem Grad der Reflexion der von einem pulsierenden Ultraschallsignal geleiteten Ultraschallwellen.
Es gibt bestimmte Echozeichen für diffuse Veränderungen der Prostata.
Das Fehlen ausgeprägter diffuser Veränderungen wird als Isoechoizität definiert und erscheint auf dem Echographiebild grau.
Die Unfähigkeit, Ultraschall zu reflektieren, d. h. die Echolosigkeit, ist bei zystischen Formationen, insbesondere Zysten, inhärent: Auf dem Echogramm befindet sich an dieser Stelle ein einheitlicher schwarzer Fleck. Das gleiche "Bild" entsteht bei einem Abszess, nur in Kombination mit einer schwachen Ultraschallreflexion - Hypoechogenität (ergibt dunkelgraue Bilder).
In den meisten Fällen ist Hypoechogenität ein Hinweis auf entzündliche Prozesse, wie beispielsweise bei einer akuten Entzündung der Prostata. Auch diffus heterogene Veränderungen der Prostata mit hypoechogenen Zonen werden sichtbar, wenn ein Gewebeödem, eine Verkalkung oder ein Ersatz von Drüsengewebe durch Bindegewebe vorliegt.
Eine Hyperechogenität – eine Reflexion der Ultraschallwellen, die von Geräten deutlich in Form weißer Punkte aufgezeichnet wird – bietet jedoch Anlass zur Diagnose von Steinen oder einer chronischen Prostatitis.
Es ist zu beachten, dass Ultraschalldiagnostikkriterien die Diagnose nicht eindeutig bestätigen oder widerlegen können: Sie informieren den Arzt lediglich über den strukturellen und funktionellen Zustand der Prostata. Zur korrekten Diagnostik gehören die rektale Untersuchung der Prostata (Palpation); Blutuntersuchungen (allgemein, biochemisch, auf Prostatakrebs), Urin, Samenflüssigkeit.
Darüber hinaus kommen weitere instrumentelle Diagnostikverfahren zum Einsatz: Miktions-Ultraschall, Zystourethroskopie, Uroflowmetrie, Doppler-Ultraschall, Computertomographie der Prostata, MRT.
Was muss untersucht werden?
Welche Tests werden benötigt?
Differenzialdiagnose
Basierend auf den Ergebnissen des transrektalen Ultraschalls und einer Reihe aller Untersuchungen wird eine Differentialdiagnose durchgeführt, da bei identischen klinischen Manifestationen dieselbe chronische Form der Prostatitis von Adenokarzinom, Blasenkrebs oder neurogener Blase bei Parkinson oder Multipler Sklerose unterschieden werden muss.
Behandlung diffuse Veränderungen an der Prostata
Wir möchten noch einmal betonen, dass es sich nicht um diffuse Veränderungen der Prostata handelt, die behandelt werden, sondern um Erkrankungen, die mit Hilfe des Ultraschalls und der daraus resultierenden Ultraschallbilder diagnostiziert werden.
Das heißt, die Behandlung wird für Prostatitis, benigne Prostatahyperplasie (Adenom), Prostatasklerose, Adenokarzinom usw. verschrieben. Medikamente zur Behandlung von Entzündungen der Prostata werden in der Veröffentlichung - Behandlung der chronischen Prostatitis sowie im Material - Tabletten gegen Prostatitis ausführlich beschrieben
Bei benigner Prostatahyperplasie gehören zu den wichtigsten Medikamenten die α-Blocker Tamsulosin (Tamsulid, Hyperprost, Omsulosin usw.), Doxazosin (Artesin, Kamiren, Urocard), Silodosin (Urorek). Sowie die Antiandrogenmittel Finasterid (Prosterid, Urofin, Finpros), Dutasterid (Avodart) usw., die die Aktivität der 5-Alpha-Reduktase reduzieren.
Tamsulosin wird einmal täglich (morgens nach den Mahlzeiten) eine Kapsel (0,4 mg) verschrieben, sofern keine Leberprobleme vorliegen. Zu den Nebenwirkungen zählen Schwäche und Kopfschmerzen, erhöhter Puls, Tinnitus, Übelkeit und Darmbeschwerden.
Das Medikament Finasterid (in Tabletten zu 5 mg) sollte ebenfalls einmal täglich eingenommen werden – eine Tablette. Es können Nebenwirkungen in Form von Depressionen, vorübergehender Erektionsstörung und allergischen Hautreaktionen auftreten.
Ärzte empfehlen das Medikament Vitaprost (Tabletten und rektale Zäpfchen) und das Medikament Palprostes (Serpens, Prostagut, Prostamol), das einen Extrakt aus den Früchten der Sabal serrulata-Palme enthält.
Diese Pflanze wird auch in der Homöopathie verwendet: Sie ist Teil des Mehrkomponentenmittels Gentos (in Form von Tropfen und Tabletten) und wird zwei bis drei Monate lang dreimal täglich eingenommen – eine Tablette (unter der Zunge) oder 15 Tropfen (innerlich). Die wichtigste Nebenwirkung ist erhöhter Speichelfluss.
Wenn Prostatazysten keine Entzündungen verursachen, wird der Zustand des Patienten überwacht und Vitamine empfohlen. Wenn die Zyste jedoch so groß ist, dass das Wasserlassen beeinträchtigt ist, ist ein Verfahren zur Sklerose angezeigt.
Wie Prostatakrebs behandelt wird, lesen Sie im Artikel Prostatakrebs
Bei Vorliegen einer Entzündung oder eines Prostataadenoms kann eine physiotherapeutische Behandlung den Zustand verbessern: UHF, rektale Elektrophorese, Ultraschall- und Magnetfeldtherapie, Massage.
Chirurgische Behandlung
Bei Prostataerkrankungen, insbesondere bei Prostataadenomen, kann eine chirurgische Behandlung in Fällen erfolgen, in denen eine medikamentöse Therapie unwirksam ist. Zu den angewandten Operationsverfahren gehören die laparoskopische transurethrale (durch die Harnröhre) Resektion der Prostata und die laparotomische Adenomektomie mit Zugang über die Blase.
Zu den minimalinvasiven endoskopischen Methoden zählen die Radiowellen-Nadelablation (transurethral), die Laser-Enkulation der Prostata, die Elektro- oder Laserverdampfung und die Mikrowellen-Thermokoagulation.
Hausmittel
Die vielleicht bekannteste Volksbehandlung für Prostataerkrankungen ist die Verwendung von Kürbiskernen, die einen Komplex aus Vitaminen mit antioxidativen Eigenschaften, Omega-6-Fettsäuren und Lignanen enthalten, die die Hormonsynthese stimulieren.
Zu den wirksamen natürlichen Heilmitteln gehören Kurkuma, grüner Tee sowie lycopinreiche Tomaten und Wassermelonen.
Informationen zur Komplementärmedizin, die bei benigner Prostatahyperplasie empfohlen wird, finden Sie unter – Traditionelle Behandlung von Prostataadenomen
Eine Kräuterbehandlung kann helfen, die Intensität einiger Symptome zu reduzieren: Aufgüsse und Abkochungen aus Brennnesselwurzeln, Kamillenblüten und Ringelblumen, Schafgarbenkraut und Weidenröschen.
Verhütung
Bislang gibt es keine Präventionsmaßnahmen gegen Prostatitis und andere Erkrankungen, die diffuse Veränderungen in der Prostata verursachen. Allgemeine Vorschriften für einen gesunden Lebensstil (ohne Alkohol, Rauchen, Liegen auf der Couch und Fettleibigkeit) wurden jedoch nicht aufgehoben.
Auch in China durchgeführte Studien bestätigten die Annahme über den Einfluss proteinhaltiger Lebensmittel auf die Entstehung von Prostataadenomen. Bei Männern über 60 Jahren, die in ländlichen Gebieten leben und mehr pflanzliche Produkte konsumieren, ist der Anteil an Prostataerkrankungen deutlich geringer als bei gleichaltrigen Stadtbewohnern, die viel tierisches Eiweiß (rotes Fleisch) und tierische Fette (einschließlich Milchprodukte) konsumieren.
Prognose
Die Prognose sichtbarer diffuser Veränderungen der Prostata hängt ganz vom Behandlungserfolg der Erkrankungen ab, bei denen diese Veränderungen per Ultraschall festgestellt wurden.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Risiko einer bösartigen Erkrankung und der Entwicklung einer Onkologie in hormonabhängigen Organen deutlich höher ist.

